
Seite 1 von 2
Michael S. Cullen
Eine Chronik des Projekts "Wrapped Reichstag"
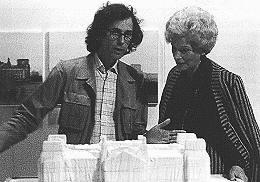
Christo und Annemarie Renger
© Aleks Perkovic


 http://www.kulturbox.de/christo/buch/cul_volz.htm (Einblicke ins Internet, ~06/1995)
http://www.kulturbox.de/christo/buch/cul_volz.htm (Einblicke ins Internet, ~06/1995)
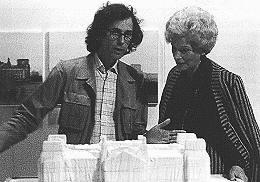
Christo und Annemarie Renger
© Aleks Perkovic
Warum ich das Projekt vorschlug? Kurz nach Eröffnung der Ausstellung "Fragen an die Deutsche Geschichte" im März 1971 entbrannte die Frage neu, was nun aus dem Reichstag werden sollte. Ich war damals von der Verbindung von Kunst und Politik fasziniert und von der Ausstellung "Kunst auf der Straße" in Hannover begeistert. Würde Christo die Idee verfolgungswert finden, so dachte ich mir, könnte man die Reichstagsverhüllung mit den beiden Themen dieser Ausstellungen in Bezug setzen. Auf die Diskussion, auf einen Dialog kam es mir an.
Daß der Vorschlag u. a. als Beitrag zur Zweckbestimmungsdiskussi-on gemeint war, mußte Christo und Jeanne-Claude nicht sonderlich interessieren, denn das Projekt hatte einen Kontext für die beiden, innerhalb dessen das Kunstwerk Gültigkeit besaß. Christo war das Reichstagsgebäude wegen der Verwicklung des bulgarischen Politikers Georgi Dimitroffs bekannt, vor allem, weil Dimitroff in Bulgarien wegen seines Auftretens im Reichstagsbrandprozeß allgegenwärtig war: Keine Stadt, kein Dorf, kein Weiler, wo nicht mindestens eine Straße oder ein Platz, möglicherweise eine Schule nach Dimitroff benannt war. Darüber hinaus erschien Christo das Reichstagsgebäude als ein städtebaulicher Unglücksfall, der für die gesamte Situation Berlins und Deutschlands stellvertretend war.
Die Jahre 1972 bis 1976 waren für das Projekt von nur geringer Be-deutung. Christo und Jeanne-Claude waren mit dem Projekt "Valley Curtain" in Rifle, Colorado (1971/1972), zu beschäftigt, um Berlin mehr Aufmerksamkeit widmen zu können, und Christo selbst hatte Angst, nach Berlin zu fliegen, weil er staatenlos war. Er war 1957 aus dem Ostblock geflüchtet und fühlte sich selbst in einem Flugzeug über der DDR nicht sicher. Dennoch wurde das Projekt bekannt, aber nur in Kunstkreisen. Auf den großen Kunstmärkten tauchten einige visionäre Zeichnungen und Collagen auf, Christo und Jeanne-Claude haben aber zum Projekt nichts gesagt.
Erst im Februar 1976 gelang es Karl Ruhrberg, dem Leiter des Berliner Künstlerprogramms des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), Christo nach Berlin zu locken. Christo machte sein Projekt in aller Form publik; prompt tauchte eine Schlagzeile auf: "Der Reichstag in Trevira". Es hagelte Proteste, Christo werde Werbung und nicht Kunst machen.
Selbstverständlich stürzten sich die meisten Gralshüter, die jahrelang nichts dagegen hatten, daß von dem alten Reichstagsgebäude der Schmuck "glatt abrasiert" wurde, die nichts dagegen hatten, wenn Volksfeste vor und parlamentsferne Konferenzen in dem Hause stattfanden, auf Christo und gingen allesamt auf die Barrikaden. Sie versuchten, seinen Vorschlag als einen Trick, Geld zu machen oder populär zu werden, als eine Kunstaktion auf Kosten des Steuerzahlers, als eine degradierende und beleidigende Aktion gegen den Reichstag in Cellophan umzudeuten. Die Leserbriefspalten waren voll damit.
Es gelang Christo und Jeanne-Claude dennoch, im Jahre 1976 Willy Brandt und die Bundestagspräsidentin Annemarie Renger für das Projekt zu gewinnen und im Laufe der Zeit auch weitere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Doch die Wahl im Oktober 1976 bedeuteten, daß die Union die stärkste Fraktion im Bundestag wurde, und da es Brauch ist, daß der Bundestagspräsident von der jeweils stärksten Fraktion nominiert und gewählt wird, erhielt Karl Carstens das Amt. Obwohl er Christo dreimal sprach, lehnte er die Reichstagsverhüllung im Mai 1977 ab, unter anderem mit dem Hinweis, die Unterstützung aus dem Berliner Senat sei nur lau.
Die Christos gaben nicht auf. Zwei Monate später, im Juli 1977, trafen sie mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Dietrich Stobbe, in seinem Amtszimmer im Rathaus Schöneberg zusammen. Stobbe für das Projekt zu gewinnen, war nicht so schwer, aber die Mitglieder seiner Partei machten es ihm nicht leicht, dafür zu werben. Als er von einem Journalisten über das Verhüllungsprojekt befragt wurde, trat er die Flucht nach vorn an und kündigte eine Preußen-Ausstellung im Reichstagsgebäude an; sie fand im Gropiusbau 1981 statt.
Der Leiter des Berliner DAAD-Büros, Wieland Schmied, war der Meinung, daß die Menschen durch Ausstellungen und Testimonials zu gewinnen seien. Christo, Jeanne-Claude und ihre Freunde bemühten sich um beides. Am 17. April 1978 gründeten Freunde, der Verleger Gerd Bucerius, Otto Wolff von Amerongen, Arend Oetker, Versteigerer Ernst Hauswedell, der Rechtsanwalt Heinrich Senfft, Wieland Schmied, Karl Ruhrberg, Michael Otto, Tilmann Buddensieg, Raimar Lüst, Petra Kipphoff und Carl Vogel, das "Kuratorium Wrapped Reichstag" und peilten eine Ausstellung in Köln an. Stets verbunden mit dem Kuratorium: Bundespräsident a. D. Walter Scheel.
Am 23. Mai 1979 wurde Karl Carstens zum Bundespräsidenten gewählt. Als Bundestagspräsident wählten Unionsparteien den bisherigen Bundestagsvizepräsidenten Richard Stücklen. Stücklen hatte nichts eiligeres zu tun, als, gleich in der ersten Nacht, seine Meinung über das Christo-Projekt zu Protokoll zu geben; das Projekt hatte erneut eine Niederlage erlitten. Jeder Versuch, zu ihm zu gelangen, schlug fehl; selbst Willy Brandt und Walter Scheel bissen bei ihm auf Granit. Und es hat dem Projekt auch nicht geholfen, daß Stücklen am 4. November 1980 in seinem Amt bestätigt wurde.
Wegen eines Bau- und Bankenskandals in Berlin mußte Stobbe im Januar 1981 zurücktreten; er wurde durch den SPD-Politiker Hans-Jochen Vogel ersetzt, bis die Wahlen im Frühjahr 1981 die Wahl von Richard von Weizsäcker zum Regierenden Bürgermeister ergaben. Für das Projekt kam ein engagierter Verfechter in den Senat: Prof. Dr. Wilhelm A. Kewenig, Jurist und nunmehr Senator für Wissenschaft und Kunst. Er hatte sich bereits vor der Wahl für das Projekt erwärmt. Ich bemühte mich, einen Termin für Christo bei Weizsäcker zu bekommen, zunächst vergebens. Dennoch hatten wir Glück.
Als Christo bei einer Podiumsdiskussion im Künstlerhaus Bethanien am 5. Mai 1982 auftrat und diese Diskussion im Fernsehen gezeigt wurde, bat Weizsäcker, der die Sendung gesehen hatte, Kewenig um ein Gespräch, das am 13. September 1982 in der Wohnung von Kewenig und seiner Frau Marianne stattfand; dies war ein großer Schritt zur Verwirklichung des Projekts. Weizsäcker wäre zu Helmut Schmidt gegangen, wenn die Regierung Schmidt-Genscher länger als bis zum Herbst 1982 gehalten hätte. Aber Helmut Kohl wurde Bundeskanzler, und Neuwahlen wurden für den 6. März 1983 ausgeschrieben; in Bonn gab es keine Gesprächspartner mehr.
Nach dieser Wahl wurde nicht Stücklen, sondern Dr. Rainer Barzel Bundestagspräsident. Just in dem Moment, in dem das Christo-"Projekt für Biscayne Bay, Miami" vollendet wurde, machte Barzel Anfang Mai dem Reichstagsgebäude seine "Aufwartung", wo er in einem kleinen Kreis zugab, daß das Christo-Projekt "Wrapped Reichstag" doch bei ihm "Gnade" finde. Mir wurde das bei der Präsentation meines ersten Buches über den Reichstag am 6. Juni 1983 berichtet. Als die Christos von Barzels Haltung erfuhren, setzten sie alles daran, mit ihm zu sprechen; tatsächlich gelang es beiden, Barzel bei einem privaten Abendessen ganz für das Projekt zu gewinnen. Nur wollte Barzel die Zeit zwischen seiner Genehmigung und der Ausführung auf wenige Monate verkürzen, was die Christos auf Grund der dafür notwendigen technischen Vorbereitungen nicht versprechen konnten. Dennoch wollte Barzel im Herbst 1984 seine Genehmigung veröffentlichen.
Inzwischen war Weizsäcker vom Amt des Regierenden Bürgermei-sters in das des Bundespräsidenten gewechselt; sein Nachfolger hieß Eberhard Diepgen, und als dieser erfuhr, daß Barzel schon im Herbst 1984 die positive Entscheidung bekanntgeben wollte, bat er diesen, die Entscheidung bis zu den Berliner Wahlen, für März 1985 vorgesehen, zurückzuhalten. Der Bundestagspräsident entsprach Diepgens Wunsch. Zwischen dem Projekt und Barzels "Ja"-Wort kam es dann zum Skandal, infolge dessen Barzel am 15. Oktober 1984 zurücktreten mußte. Als sein Nachfolger wurde am 5. November der ehemalige Kanzleramtsminister Philipp Jenninger gewählt.
Im Sommer 1985 realisierten die Christos das Projekt in Paris "Pont-Neuf empaqueté" und erhielten viel Zustimmung inner- und außerhalb der Kunstwelt. In Berlin waren beide besonders willkommen und kamen auf Einladung des neuen Senators für Kulturelle Angelegenhei-ten, Dr. Volker Hassemer, im Dezember nach Berlin. Zu dem Christo-Team von Christo, Jeanne-Claude, Wolfgang Volz und mir stieß An-fang Dezember 1985 der Bauträger Roland Specker, der 1986 den Ver-ein "Berliner für den Reichstag" gründete, um Unterschriften für das Verhüllungsprojekt zu sammeln. Obwohl Hassemer sich für das Projekt sehr erwärmen konnte, gelang es ihm nicht, Jenninger zu überzeugen. Jenninger wollte, daß die Christos bei ihm um einen Termin anfragen.
Während Speckers Unterschriftensammlung lief, bemühten sich die Christos um einen Termin, der endlich für den 17. Juni 1987 vorgesehen war. Doch Jenninger ließ in einem Vorabinterview mit dem Tagesspiegel am 3. Juni wissen, daß er Christo dabei nur seine Gründe für seine ablehnende Haltung mitteilen würde. Als Christo dies las, war ihm klar, daß der Termin nichts bringen würde. Kurz nachdem Specker und der Vereinsvorsitzende Dr. Friedrich Wihelm Wiethege Jenninger die gesammelten 70.000 Unterschriften überbracht hatten, kabelte Christo nach Bonn, er sei krank und könne nicht kommen. Das Projekt stagnierte. Aber nicht für lange.
Wegen einer mißglückten Rede zur Reichsprogromnacht vor dem Bundestag am 10. November verließen die meisten Abgeordneten den Plenarsaal, und am nächsten Tag, am 11. November, räumte Jenninger seinen Stuhl; an seine Stelle trat Prof. Dr. Rita Süssmuth, früher Ministerin für "Familie" - die Wahl fand am 25. November 1988 statt. Um ein ähnliches Debakel wie bei Stücklen zu verhindern, erhielt sie Informationen aus erster Hand über das Projekt. Doch zunächst schien keine Wende in Sicht; ein Besuch von Specker und Frau Kewenig bei Frau Süssmuth im September 1989 brachte wenig mehr als eine vage Hoffnung. Christo und Jeanne-Claude beschäftigten sich mit der Realisierung des großen Projekts "Umbrellas" in Kalifornien und Japan.
Die "Wende" vom November 1989 war auch die Wende für das Projekt. Mit dem Fall der Mauer und mit der deutschen Einheit kam der Wunsch, dem Grundgesetz gemäß den Sitz der Regierung von Bonn nach Berlin zu verlegen. Und erneut war das Reichstagsgebäude zum Kristallisationspunkt deutscher Einheitssehnsucht geworden. Auf die Frage, ob er noch immer an seinem Plan festhalte, antwortete Christo: "Jetzt erst recht!" Doch: Würde Berlin Hauptstadt werden, und würde ggf. das Reichstagsgebäude Parlamentshaus des Bundestags sein?
Aufgrund eines Passus im Einigungsvertrag, wonach zwar Berlin Hauptstadt, über den Sitz von Parlament und Regierung aber später zu entscheiden sei, tobte ein langer Kampf zwischen den Befürwortern Bonns und Berlins. Über diesen Hauptstadtkampf ist viel geschrieben worden, auch über die Abstimmung am 20. Juni 1991, wonach Berlin nicht nur dem Namen nach Hauptstadt, sondern auch Sitz von Parlament und Regierung werden solle, und, daß der Umzug binnen vier Jahren zu erfolgen habe. Am Tage nach der Entscheidung forderte der CDU-MdB Friedbert Pflüger, Frau Süssmuth möge schließlich doch noch der Verhüllung des Reichstags zustimmen. Als ich bemerkte, daß dies im Einvernehmen mit dem Büro der Präsidentin erfolgte, besuchte ich sie, um von ihr zu erfahren, daß sie "fest entschlossen sei", das Projekt zu realisieren. Als ich Christo und Jeanne-Claude davon erzählte, reagierten sie zunächst ungläubig; zu oft hatten sie ähnliches gehört.
Nach dem Projekt "Umbrellas" im Oktober 1991 schienen nur noch zwei Fragen ungeklärt: a) Würde der Bundestag das Reichstagsgebäude als Tagungsort wählen?, und b) würde Frau Süssmuth Christo und Jeanne-Claude die Erlaubnis geben, das Haus zu verhüllen?
Die erste Frage wurde am 30. Oktober 1991 geklärt. Der Ältestenrat hatte sich für das Reichstagsgebäude ausgesprochen; das bedeutete, daß das Reichstagsgebäude bald nicht mehr für eine Verhüllung disponibel sein würde. Jetzt setzte ich alles daran, daß Frau Süssmuth die Christos kennenlernte. Mir war in Erinnerung geblieben, wie die Christos auf Journalistenfragen hinsichtlich des Reichstagsprojekts während des Umbrellaprojekts reagierten: "Wenn die Deutschen wollen, daß der Reichstag verhüllt wird, müssen sie mir schreiben". Das Wichtigste war, daß Frau Süssmuth die Christos kennenlernte. In den ersten Novemberwochen habe ich sie mehrfach darauf aufmerksam gemacht und sie am 12. Dezember in Bonn besucht, bis sie am 20. Dezember das Künstlerehepaar nach Bonn einlud.
Am 9. Februar 1992 kam es also zu der ersten Begegnung zwischen Frau Süssmuth, Christo und Jeanne-Claude, in der Amtsresidenz der Bundestagspräsidentin in Bonn. Anwesend waren auch Conradi, die Süssmuth-Mitarbeiter Müller und Jung, Roland Specker, Wolfgang und Sylvia Volz und ich. Es gab unterschiedliche Meinungen über den anzustrebenden Termin. Die Bundestagsvertreter wollten spätestens den 20. Juni 1995 als Umzugstermin, Jeanne-Claude wollte so viel Zeit wie möglich haben, weil sie sonst in Zeitnot bei den Vorbereitungen kommen würden. Übereinstimmung bestand in der Frage der Überzeugungsarbeit in Bonn, die möglichst von einer Ausstellung flankiert sein sollte.
