
Wolf Jobst Siedler
Fußnote in der Geschichte des Belanglosen
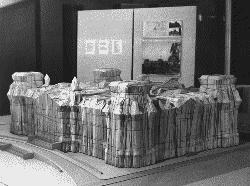
Modell von Christo und Jeanne-Claude
© Presse- und Informationsamt der Bundesregierung


 http://www.kulturbox.de/christo/buch/siedler.htm (Einblicke ins Internet, 10/1995)
http://www.kulturbox.de/christo/buch/siedler.htm (Einblicke ins Internet, 10/1995)
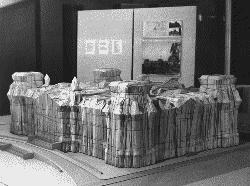
Modell von Christo und Jeanne-Claude
© Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
Seit genau zwei Jahrzehnten kämpft Christo für seine Reichstagsverkleidung - und mit ihm jene verschworene Gemeinde, die darin ein künstlerisches Ereignis sieht. Jetzt hat seine Beharrlichkeit zum Ziel geführt. Rita Süssmuth ist heute eine geradezu leidenschaftliche Fürsprecherin von Christo. Eberhard Diepgen ist der zweite Politiker, dessen Wort in dieser Sache zählt, denn schließlich ist er der Regierende Bürgermeister der Stadt, in der Wallots Reichstagsgebäude steht. Seine abwartende Vorsicht hat im Laufe der Jahre immer deutlicher einer Sympathie für Christos Verhüllungskunst Platz gemacht.
In der Weimarer Zeit haben sich die Reichstagspräsidenten und Oberbürgermeister in künstlerischen Streitfragen peinlich zurückgehalten. Aber heute will jedermann ihre Stellungnahme hören, und wie die Dinge stehen, war ihr Votum ausschlaggebend. Die Reichstagsumhüllung ist Berlin nicht erspart geblieben. Es ist der letzte Moment für ein solches Spektakel, denn über kurz oder lang werden die Handwerker anrücken, um die Gerüste für den Umbau des neuen Domizils für das Parlament aufzustellen. Dann ist es zu spät. Christo hat am Ende gesiegt.
Mit was für dürftigen Erfindungen man doch ein Lebenswerk bestreiten kann. Mitte der fünfziger Jahre hat der in Bulgarien geborene - ja, was ist Christo eigentlich (?): Maler (aber er malt nicht wirklich), Bildhauer (aber es gibt keine Skulpturen von ihm), Graphiker (aber sie sind eigentlich nur ein Nebenprodukt seiner Arbeit), sagen wir also - Künstler seine erste "Verhüllung" inszeniert. Seit dem ist Christo ständig mit Verhüllungen beschäftigt, und er erregt immer aufs neue Aufmerksamkeit damit.
Das eine Mal sind es Architekturen wie etwa eine Brücke über die Seine in Paris. Das andere Mal hat er sich eine ganze Landschaft vorgenommen, auf die er aufmerksam macht, indem er einen running fence in der Wüste installiert. Das dritte Mal haben es ihm Inseln im Ozean angetan, die er mit höchst profanen Stoffbahnen umhüllt. Immer ist es die Flüchtigkeit seiner Kunstwerke, denen er eine vergängliche Dauer verleihen will.
Jetzt sind es schon fünfunddreißig Jahre, in denen er dergleichen Kunststücke vorführt, und das Staunenswerteste daran ist, daß jedesmal wieder das Spektakel die Kunstwelt bewegt.
Seit zwei Jahrzehnten ist es das Berliner Reichstagsgebäude, das es ihm angetan hat. Natürlich hat das Vorhaben wieder jene Welt erregt, die in solchen Fällen immer zur Stelle ist - Kunstkritiker, die Wortführer der öffentlichen Meinung und notgedrungen auch Vertreter des Staates, die ihre Genehmigung geben mußten. Es geht ja um den Sitz des alten Reichstags, der eines Tages das neue Parlament beherbergen wird, der nun "verhüllt" wird. Die Öffentlichkeit ist von all dem Hin und Her ziemlich unberührt geblieben. Fragte man auf der Straße beliebige Passanten in München, Frankfurt oder Hamburg, was sie von der Umhüllung des Reichstagsgebäudes halten, so wäre vermutlich dabei herausgekommen, daß nur eine verschwindende Minderheit von dem Vorhaben gehört hätte, das die Feuilletonseiten unserer Presse seit mehr als zwei Jahrzehnten beschäftigt.
Dinge wie Christos Aktionskunst sind geradezu ein Lehrstück für den Unterschied zwischen der veröffentlichten und der öffentlichen Meinung. Man soll also nicht zu schnell davon reden, daß das Projekt des liebenswürdigen Künstlers die Bürgerschaft spalte, um deren Haus es ja hier schließlich geht. Halten wir also fest: Es ist eine Auseinandersetzung unter Intellektuellen, die Intellektuelle in Aufregung versetzt. Dagegen ist nichts zu sagen, die großen Auseinandersetzungen geistiger Art sind ja meist solche einer Minderheit.
Reden wir also von der Sache selber. Das Reichstagsgebäude Wallots, das vom neugegründeten Kaiserreich Bismarcks gebaut wurde, ist nicht gerade ein großes Werk der Berliner Architektur, noch nicht einmal ein Markstein der Moderne. Das Neue Bauen hat in Berlin viel bedeutendere Werke hervorgebracht, von den AEG-Hallen des Peter Behrens bis zu dem grandiosesten Kaufhaus des Kontinents, dem Warenhaus Wertheim am Leipziger-Platz. In Filmaufnahmen des 17. Juni 1953 ist es im Hintergrund der demonstrierenden Menge noch zu sehen; erst Jahre danach wurde es aus dem gleichen Neuerungswahn abgerissen, dem im Westteil der Stadt ungefähr gleichzeitig Schwechtens Anhalter Bahnhof zum Opfer fiel, der mit seiner kühnen Dachkonstruktion von Seidel zur bedeutendsten Eisenbahnarchitektur Europas gehörte.
Wallots Reichstagsgebäude ist ein typischer Wilhelminischer Bau, genauso pompös-auftrumpfend wie Raschdorffs Dom am anderen Ende der Linden. Es ist, nebenbei gesagt, ein Trauerspiel, daß das Belangloseste der Jahrhundertwende erhalten blieb oder, richtiger gesagt, wieder aufgebaut wurde, während die Meisterwerke des Barock, das Stadtschloß und das Schloß Monbijou, gesprengt wurden, obwohl sie doch viel besser erhalten waren.
Also die künstlerische oder kunsthistorische Bedeutung der Architektur kann es nicht sein, die Christo so enthusiastisch von dem Bau reden läßt und die seit zwanzig Jahren zu immer erneuten Auseinandersetzungen führt. Was ist es dann, was zu jenem nicht nachlassenden Meinungsstreit führt? Zuerst, in den siebziger Jahren, hat Christo gesagt, daß er das Parlament durch die Verhüllung hervorheben, nämlich enthüllen wolle, damit jener Bau in das Bewußtsein trete, in dem Hitler seine großen Reden hielt und das Dritte Reich seine Exzesse feierte. Dann wurde er sehr schnell belehrt, daß der Reichstag ja schon wenige Wochen nach der Machtübernahme durch einen nie geklärten Anschlag ausbrannte und Hitlers große Reden hier nie gehalten wurden. Er kannte sich genauso wenig in der Geschichte aus wie die Bundestagspräsidentin, die sich anfangs vehement gegen die Verwendung des Reichstagsgebäudes für den Bundestag wehrte, weil es durch den Nationalsozialismus zu sehr belastet sei. Rita Süssmuth wie Christo mußten zur Kenntnis nehmen, daß der Reichstag des Dritten Reiches seit dem Frühjahr 1933 in der gegenüber der Reichstagsruine liegenden Krolloper des 19. Jahrhunderts getagt hatte.
Aber das focht Christos Neigung zum Reichstagsgebäude nicht an; er zog hilfsweise ein anderes Argument heran. Es gäbe keinen Ort in Europa, sagten er und die Verteidiger des Verhüllungsprojekts, der in vergleichbarem Maße hart an der Mauer stehe und ein Symbol der Teilung Berlins, Deutschlands und Europas sei. In zwanzig Jahren wird viel gesagt, aber durchmustert man die Archive des in dieser Zeit Geschriebenen, so findet man die scharfsinnigsten und gegensätzlichsten Begründungen, weshalb gerade der seit mehr als sechs Jahrzehnten leer stehende Bau verhüllt werden müsse. Nun ist mit der Mauer in Berlin die Barriere in Europa gefallen. Wo ist der Symbolcharakter des Bauwerkes geblieben?
Warum also muß eben an dieser Stelle das neueste Aktions-Kunststück stattfinden, wenn der Reichstag weder der Versammlungsort der Gewaltherrschaft noch der Brennpunkt der Spaltung der Welt ist? Christo weiß das selbst nicht genau, er sagt mit symphatischer Offenheit, daß er eben "ein intuitiver Mensch" sei, das Gebäude wirke auf ihn "wie ein Magnet". Christo trennt sich von seinen gestrigen Argumenten so schnell wie er sie fand. Wäre ihm sein Wunsch in den siebziger oder achtziger Jahren erfüllt worden - sagt er heute -, so hätte seine Verhüllung "ja nur eine Fußnote in der Geschichte des Kalten Krieges" dargestellt.
Seinen wahren Sinn habe die Verkleidung mit silberglänzenden Kunststoffbahnen erst im Laufe der Zeit gewonnen, eigentlich gerade in diesem Moment. Sehr bald schon werde der Reichstag ja von Baugerüsten umgeben sein, eben jetzt sei der richtige Augenblick, ihn zu verkleiden, und die ausländerfeindlichen Ausschreitungen hatten seiner Verhüllungsaktion eine neue, eine zusätzliche Rechtfertigung gegeben. Die Deutschen würden auf ihre nationale Geschichte hingewiesen und auf ihre Verpflichtung, die Mitte Europas zum Hort des Friedens zu machen.
Nun ja, die Argumente kommen und gehen, man soll sie nicht allzu ernst nehmen. Wer hätte Zweifel daran, daß Christo morgen neue Begründungen für die Notwendigkeit einer Verhüllung finden würde, wenn sich die Lage ändert? Der Kunstwert des Spektakels wird sich in ziemlich engen Grenzen halten, aber der Schaden auch.
Wer redet denn ernsthaft noch davon, daß die Würde der deutschen Volksvertretung beschädigt wird, wenn ein künstlerisch ziemlich zweifelhaftes, 1933 ausgebranntes Gehäuse für einige Wochen verhüllt wird? Niemand wird ja wohl meinen, daß seine jetzige Nachkriegs-Architektur aus dem Geiste der fünfziger Jahre sakrosankt ist, denn man schickt sich ja gerade an, am Reichstag für nahezu eine Milliarde Mark aufs neue herumzulaborieren, um ihn für den Bundestag nutzbar zu machen.
Das Spektakel Christos soll in Gottes Namen stattfinden. Vielleicht führt es neue Touristen nach Berlin, und das kann eine Stadt gebrauchen, der die Wiedervereinigung bisher vor allem Enttäuschungen gebracht hat. Der Leerstand des Reichstags auch Jahre nach der Wiedervereinigung - und wohl noch für ein weiteres Jahrzehnt - ist der eigentliche Skandal und nicht seine zeitweilige Verkleidung.
