
Peter Conradi
Impulse für die Architektur von Parlament und Regierung in Berlin
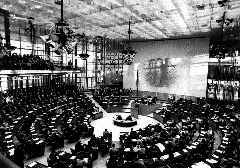
Plenarsitzung des Bundestages im Behnisch-Bau, 1994
© Deutscher Bundestag

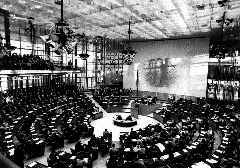
Plenarsitzung des Bundestages im Behnisch-Bau, 1994
© Deutscher Bundestag
Die Verhüllung des Reichstagsgebäudes durch Christo. Die deutliche Mehrheit von 292 Ja-Stimmen zu 223 Nein-Stimmen bei 9 Enthaltungen für die Verhüllung des Reichstagsgebäudes durch Christo nach der Bundestagsdebatte am 25. Februar 1994 hatte niemand erwartet.
525 von 661 Bundestagsabgeordneten nahmen an der namentlichen Abstimmung teil. Diese Abstimmung gehörte zu den seltenen Entscheidungen des Parlaments, bei denen nicht entlang der Fraktionsgrenzen, sondern frei abgestimmt wird. Das gab der Debatte und Abstimmung einen besonderen Reiz, ähnlich wie bei der fraktionsoffenen Debatte und Abstimmung über die Hauptstadtfrage am 20. Juni 1991. Solche Abstimmungen sind - leider - selten im Deutschen Bundestag.
Bei der Abstimmung über das Christo-Projekt gab es keinen Fraktionszwang. Im Plenum gab es dann Befürworter und Gegner des Projekts auf allen Seiten, wenn auch die Befürworter bei der SPD, die Gegner bei der CDU/CSU deutlich überwogen.
Nach der Geschäftsordnung des Bundestags beschließt der Ältestenrat über die inneren Angelegenheiten des Hauses. Dort gab es eine knappe Mehrheit für das Projekt. Die Gegner des Projekts in der CDU/CSU und FDP - vor allem der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Schäuble - erzwangen deshalb eine Plenardebatte und eine namentliche Abstimmung in der Erwartung, im Plenum des Bundestags eine Mehrheit gegen das Projekt zu finden.
In der Debatte über den interfraktionellen Antrag "Verhüllter Reichstag - Projekt für Berlin" (Drs. 12/6767) spielten die künstlerischen und architektonischen Aspekte des Projekts nur eine untergeordnete Rolle. Für die Abgeordneten waren andere Überlegungen maßgebend.
Gegner des Projekts befürchteten, die Bevölkerung werde die Verhüllung des Reichstagsgebäudes nicht verstehen; durch die Aktion werde die Entfremdung zwischen Volk und Volksvertretung gefördert: "Haben die in Bonn nichts Wichtigeres zu diskutieren?" Viele Abgeordnete scheuten die Diskussion mit den WählerInnen im heimatlichen Wahlkreis, zumal schwer zu vermitteln schien, daß der Künstler die Aktion selbst finanziere, mithin keine Steuergelder dafür verwendet würden.
Andere Gegner des Projekts argumentierten, mit der Verhüllung werde das nationale Symbol Reichstagsgebäude beschädigt. So vor allem der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Wolfgang Schäuble, dessen national-pathetische Rede gegen das Projekt vermutlich einige skeptische FDP- und SPD-Abgeordnete bewog, für das Projekt zu stimmen.
Die Befürworter der Aktion wollten mit Christos Umhüllung des zukünftigen Parlamentsgebäudes in Berlin ein Zeichen für den Neuanfang des Bundestags in Berlin setzen, zugleich ein Zeichen für die Offenheit, Gelassenheit und Toleranz, auch für das Selbstbewußtsein des Parlaments. Die Umhüllung des Gebäudes sollte den neuen Abschnitt in der Geschichte unseres Landes und des Reichstagsgebäudes markieren.
Paul Wallots Architektur drückte indessen nicht nur die wachsende Macht der vom Volk gewählten Vertretung gegenüber dem Kaiser aus, das Reichstagsgebäude war vielmehr Zeichen für die 1871 endlich gewonnene nationale Einheit Deutschlands und dokumentierte nach innen und nach außen das politische und wirtschaftliche Gewicht des geeinten Deutschlands.
Insoweit hatte die politische Situation bei der Planung und beim Bau des Reichstagsgebäudes vor rund hundert Jahren Ähnlichkeiten mit der heutigen Situation. Die 1989/1990 wieder gewonnene Einheit macht die Bundesrepublik Deutschland zum bevölkerungsstärksten und wirtschaftlich größten Staat in Europa. Verständlich, daß unsere Nachbarn sorgfältig beobachten, wie das neue Deutschland sich gibt!
Bei der Mehrheitsentscheidung für Christos Reichstagsverhüllung am 25. Februar 1994 spielte sicher auch eine Rolle, daß einige Abgeordnete das Reichstagsgebäude als fremd, als nicht unserer Demokratie gemäß empfanden. Vieles spricht dafür, daß vor allem rheinische und süddeutsche Abgeordnete, die mehrheitlich gegen Berlin als Hauptstadt gestimmt hatten, mit ihrem Votum für die Umhüllung ein Zeichen gegen das ungeliebte Reichstagsgebäude setzen wollten.
Günter Behnischs neuer Plenarsaal (1992) brachte eine neue Architektur nach Bonn. Der Bundestag hatte den Neubau nach einer fünfzehnjährigen, mühsamen und umstrittenen Planung am 5. Juni 1987 beschlossen. Leider hatte uns niemand gesagt, daß 1990 die deutsche Einheit kommen werde! Der Neubau war 1990 zu zwei Dritteln fertiggestellt; 1992 zog der Bundestag vom provisorischen Plenarsaal im "Wasserwerk" in den neuen Plenarsaal um.
Der Plenarsaal erregte im Inland wie im Ausland großes Aufsehen. Günter Behnischs Gebäude macht Offenheit und Durchlässigkeit baulich erkennbar. Seine heitere Festlichkeit wurde von den Kritikern als eine gelungene, lässige Selbstdarstellung des Parlaments gelobt.
Unter den Abgeordneten waren die Meinungen - wie immer - geteilt. Die Konservativen bemängelten die Leichtigkeit des Gebäudes, die fehlende Würde, das Spielerische. Ihnen wäre eine Würde-Architektur im Stil der deutschen Banken mit Säulen und Portalen, mit Marmor und Mahagoni, lieber gewesen. Anderen, meist jüngeren Abgeordneten und den meisten Besuchern hingegen gefiel der neue Saal mit seinen Ausblicken auf den Rhein und die Umgebung, in seiner modernen Gestalt mit der kommunikationsfreundlichen kreisrunden Sitzordnung.
Die Erfahrungen mit dem neuen Plenarsaal dürften zur Mehrheitsentscheidung für die Reichstagsumhüllung beigetragen haben. Mit der Verhüllung bringt der Bundestag etwas von der Leichtigkeit und Fröhlichkeit Bonns in das preußisch-protestantische, gelegentlich säuerliche Berlin. Die Aktion Christos markiert den Beginn der Umbauarbeiten am Reichstagsgebäude. Sie gibt dem Reichstagsgebäude wenigstens für eine kurze Zeit etwas von den spielerischen Qualitäten der Plenarsaalarchitektur Günter Behnischs.
Nach der Vereinigung gelang es Christo, auch in Berlin Befürworter für die Reichstagsumhüllung zu finden. Es waren allerdings mehr Überlegungen der Zweckmäßigkeit als der Kunst, die diesen Meinungsumschwung bewirkten. Mit der Umhüllungsaktion werde ihre Stadt, so hofften die Verantwortlichen, aus dem Schatten des Provinzialismus heraustreten und als neue deutsche Hauptstadt weltweit Beachtung und Anerkennung finden.
In Berlin begann zu dieser Zeit die Auseinandersetzung um eine neue Architektur, die sich an Schinkels Klassizismus, nicht an der modernen Architektur der zwanziger Jahre und der Nachkriegszeit ausrichten sollte. Nicht Offenheit und Vielgestaltigkeit, nicht Diskurs und Widerspruch sollten das Berlin der neunziger Jahre bestimmen, sondern eine uniforme, pseudoklassizistische Blockarchitektur. Mendelsohn, Mies van der Rohe, Fahrenkamp, Scharoun und Gutbrod dürften heute in der Berliner Stadtmitte nicht mehr bauen.
Dieser Berliner Tendenz zur teutonischen Schwere, zum "steinernen Berlin" der mit dünngesägten Natursteinplatten verkleideten, blockfüllenden Bürocontainer ist die Aktion Christos alles andere als willkommen. "Zur Zeit der Mauer war Berlin offener als heute", beklagt der Architekt Rem Kohlhaas. Freundlichkeit, Heiterkeit, Spiel und Fantasie - das sind Fremdworte für die Architektur-Gewaltigen im Berlin der neunziger Jahre.
Bundestag und Bundesregierung hatten es bei diesen Tendenzen nicht leicht, ihre Architekturvorstellungen in Berlin einzubringen. Berlin widersetzte sich allen Versuchen, etwas von der "Bonner Leichtigkeit des Seins" mit nach Berlin zu bringen. Der Senatsbaudirektor setzte sich vehement für Blockarchitekturen ein, die in ihrer architektonischen Ausformung den Bauten der NS-Zeit näher sind als den Bauten des demokratischen Deutschland. Trotzdem gelang es, für die Neubauten des Bundestags in den Dorotheen-Blöcken und im Alsen-Block Architekten zu gewinnen, deren bisherige Arbeiten für eine Architektur unserer Zeit, nicht für eine Beschwörung der Vergangenheit stehen.
Architekturformen sind ebenso wenig beliebig wie Worte. Sie zeigen, was uns wichtig ist. Das neue Deutschland, eine zivile, demokratische Republik, sollte sich in der baulichen Gestalt der Demokratie um Freundlichkeit, Gelassenheit und Rücksicht bemühen, nicht um angestrengte Würde oder einschüchternde Feierlichkeit.
Ob es gelingt, für die Parlamentsbauten in Berlin den Qualitätsmaßstab zu halten, den der Bundestag mit Behnischs Plenarsaal in Bonn gesetzt hat, bleibt abzuwarten. Christos Umhüllung des Reichstagsgebäudes sollte dafür ein gutes Omen, eine Ermutigung sein.
