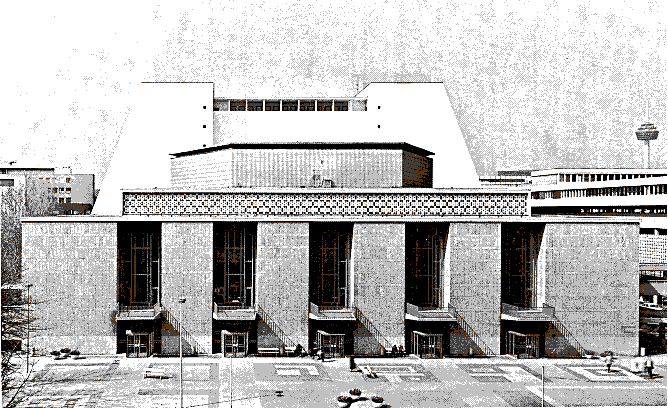Daten und
Geschichte des
Opernhauses
-
- Länge: ca. 120 Meter
- Breite: ca. 78 Meter
- Höhe (Pylone): 35 Meter
- Bauvolumen: 175.000 Kubikmeter
- Zuschauerraum:
- Fassungsvermögen 1346 Plätze
- Länge bis zum Eisernen Vorhang: 30 Meter
- Breite 26 Meter
- Mittlere Höhe: 15 Meter
- 22 Logen
- Bühne:
- Hauptbühne: Fläche 25*22=550 Quadratmeter, Höhe 29 Meter, Schnürboden mit 60 Handzügen und 2 Elektrozügen
- Hinterbühne: Fläche 25*20=500 Quadratmeter, Wagen mit Drehscheibe
- Linke Seitenbühne: Fläche 22*18=396 Quadratmeter
- Rechte Seitenbühne: Fläche 18*17=306 Quadratmeter
- Bühnenrahmen: Breite maximal 13,2 Meter, Höhe maximal 8 Meter
- Orchestergraben:
- Fläche 110 Quadratmeter
- Fassungsvermögen ca. 90 Musiker
- Baukosten:
- 15 Millionen DM
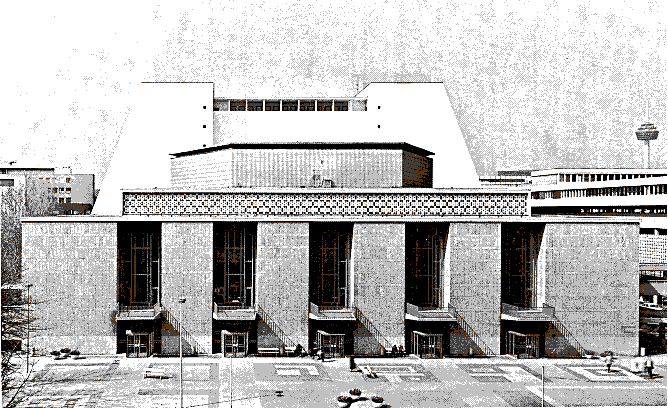
Am 13. September 1954 begann der Erdaushub für die neue Kölner Oper; knapp drei Jahre später, am 18.Mai 1957 fand die Eröffnung des vollendeten Großen Hauses statt. Wie bei keinem anderen Bau Kölns aus der frühen Nachkriegszeit wurden die Diskussionen über die Planungen, Wettbewerbe und die Ausführung dieses damals größten Kulturgebäudes Deutschlands von der Presse begleitet und der Bevölkerung verfolgt. Hunderte von Besuchern aus aller Welt wurden täglich auf der Baustelle, der gröten im Köln der 50er Jahre, gezählt. Hervorgehoben wurde die "Größe und Intimität" und die Paarung von "Logik und Atmosphäre" wie auch die "Einmaligkeit" der Architektur. Konrad Adenauer sprach in seiner Eröffnungsrede von der "geistigen Schöpfung", die dieses Haus darstellt. Anteil genommen hatte die Kölner Bevölkerung alleine wegen der ungewöhnlichen Architektur mit den schräg aufsteigenden Pylonen - und vor allem mit Humor, sei es im Karneval oder bei den zahlreichen Namensfindungen für dieses Haus: "Grabmal des unbekannten Indentanden", "Trockendock", "Denkmal für Ramses II", "Prälatenbunker" ... Der Volksmund hatte die Oper, Werk eines "echten kölschen" Architekten, noch vor der Vollendung in seiner Eigenwilligkeit akzeptiert und ihn als Bau mit Lokalkolorit anerkannt.
Die Planungen zum neuen Opernhaus reichen zurück bis in das Jahr 1945. Im Rahmen der Neustrukturierung der gesamten Innenstadt, die im Krieg bis zu 95% zerstört worden war, stand seitens der Wiederaufbaugesellschaft - anfangs unter der Leitung von Eugen Blanck und ab 1946 von Rudolf Schwarz - ein Wiederaufbau der Ruine des alten Opernhauses am Rudolfplatz nur am Rande zur Diskussion. Die Vorstellungen von einer veränderten Verkehrssituation, von neuen Anforderungen an die Bühnentechnik und seiner zeitgemäßen Architektur führten so schon 1946 zur Ausschreibung eines Wettbewerbs für einen Neubau an anderer Stelle. Erst durch die Konfrontation mit diesem Wettbewerbsergebnis kam es zu einer intensiveren Beschäftigung mit den Erhaltungsmöglichkeiten der 1902 nach Entwürfen von Carl Moritz fertiggestellten und im Krieg nur teilweisen zerstörten Oper. Der spektakuläre Wiederaufbauvorschlag - allerdings mit einer stark purifizierten Fassadengestaltung - stammte von dem Architekten Hermann von Berg. Ihm gegenüber standen vor allem die Gutachten von Walter Unruh und Adolf Linnebach aus dem Jahre 1947, die letztendlich den Ausschlag für die verwaltungsmäßige und politische Entscheidung gaben. Vorrangig aus Gründen der neuen Verkehrsführungen beschloß man am 18.Juni 1951 den Abbruch der alten Oper und den Neubau im Bereich der Glockengasse.
Am 18. Mai 1957 wurde das neue Opernhaus mit einem Festakt und mit der Premiere von Carl Maria von Webers "Oberon" eröffnet. Das
Opernhaus wurde bis zur Eröffnung des Schauspielhauses (8.9.1962) zunächst als Dreispartentheater für Oper, Ballett und Schauspiel
benutzt.
Zur Hauptseite der Kölner Oper.
Matthias Brixel, Letzte Änderung am 28.5.95