
Seite 2 von 2
Hermann Glaser
Ästhitizismus als Entethisierung der Politik


 http://www.kulturbox.de/christo/buch/glaser2.htm (Einblicke ins Internet, 10/1995)
http://www.kulturbox.de/christo/buch/glaser2.htm (Einblicke ins Internet, 10/1995)
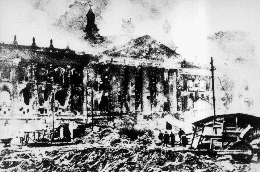
Berlin, 1945
© Panin_Schagint/Voller Ernst
Angesichts der ausgeprägten Rechtstendenzen in der bundesrepublikanischen Gesellschaft kann man bei Jüngers abgründiger politischer Publizistik - nachzulesen etwa in dem von Renate Haßel und Bruno W. Reimann herausgegebenem Jünger-Brevier - nicht von Tempi passati sprechen. Humane Identität bedarf des sensiblen Blicks zurück nach vorn.
"Die echte Revolution hat noch gar nicht stattgefunden, sie marschiert unaufhaltsam heran. Sie ist keine Reaktion, sondern eine wirkliche Revolution mit all ihren Kennzeichen und Äußerungen, ihre Idee ist die völkische, zu bisher nicht gekannter Schärfe geschliffen, ihr Banner das Hakenkreuz, ihre Ausdrucksform die Konzentration des Willens in einem einzigen Punkt - die Diktatur! Sie wird ersetzen das Wort durch die Tat, die Tinte durch das Blut, die Phrase durch das Opfer, die Feder durch das Schwert. [...] Das sind die Ziele, für die auf unseren Barrikaden gefochten wird!" (Jünger 1926: XI; Jünger 1923: 33; vgl. Sontheimer 1962: 128)
Rüstiges Hoch-Alter, sich grandseigneurial gebend und von der Politik (einschließlich des Bundespräsidenten) nobilitiert, sollte von der Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit diesem deutschen Verhängnis nicht ablenken. Das "Ideal eisiger und ironischer Eleganz" (Johannes Hofmiller) verweist einfache Sittlichkeit in den Schatten. Désinvolture kokettiert mit dem sich immer mehr als Anästhetik ausbreitenden Ästhetizismus. Jünger als Erz- und Oberdandy (Oswald Wiener) wird von den "neuen Eliten" als heroisches Aphrodisiakum estimiert. "Vor allem, daß man Jüngers Désinvolture als Exerzitium gegen das steril-aufgeregte Geschwätz zu entdecken beginnt, daß man entdeckt hat, welch ein Dichter unter uns all die Jahrzehnte lebte und lebt..." (Bohrer 1995: 342 und 328ff.)
Wie die Politik auf den "sozio-kulturellen Nihilismus" von Jünger und Jüngers Jüngern reagiert, bestätigt die ihr unterstellte Mediokrität. Sie reagiert nämlich überhaupt nicht - entzieht sich der kulturpolitischen Herausforderung mit Hilfe einiger Verehrungsgesten gegenüber dem "alten Soldaten", der, als er jung war, der Demokratie kein Pardon gab.
Beim harmlosen Christo ereignete sich eine parlamentarische "Sternstunde". In zutiefster Sorge um die demokratische Würde tremolierte Wolfgang Schäuble. Vertreter aller Parteien intonierten lustvoll die Marseillaise revolutionären Kunst-Verständnisses. Rita Süssmuth war natürlich wie immer ein Ausbund an Toleranz, Empathie und Vernunft. Auf dem völlig unwichtigen Schauplatz eines ästhetischen Scheingefechts zeigte das Parlament, daß es mit nachtwandlerischer Sicherheit an den eigentlich bewegenden kulturellen Zeitfragen vorbeischreitet. Der Verpackungskünstler Christo, von Großkritikern abgeschirmt, verhüllt so, ehe er überhaupt den Reichstag verhüllt, Aufklärung: man hängt sich an ihn an, um nicht das unvollendete Projekt Aufklärung angehen zu müssen. Der Ästhetik wird die Ethik ausgetrieben ("Gesinnungsästhetik" wird denunziert), Kalokagathie, die Dreieinheit des Guten, Schönen und Wahren, aufs Allein-Schöne (und damit den Schein) reduziert. Der von den politischen Spitzen und Stützen mitgemachte, aber nicht wahr-genommene Postmodernismus (anything goes - don't worry, be happy - all is beautiful) mißachtet die ästhetische Erziehung des Menschen (handsome is, who handsome does) und damit die Hoffnung auf eine demokratisch-humane Identität, deren Bei-sich-selbst-sein sich aufs Anderssein, also den Plural von Identitäten, hin öffnet.
"Ein Terror liegt über dem Land" - so begann Karl Heinz Bohrer sein Grundsatzreferat auf dem Kongreß "Die Aktualität des Ästhetischen", der im September 1992 in Hannover stattfand. Mit "Terror" meinte der Redner den Verlust der Eigengesetzlichkeit der Kunst gegenüber grassierenden Nutzanwendungen "sozialhygienischer oder konsumveredelnder Art" er opponierte gegen die moralisch-philosophisch, sozial-emanzipatorisch oder hedonistisch-kulturell motivierte Entgrenzung des Ästhetischen, bei welcher der substantielle Kern des ästhetischen Diskurses verloren zu gehen drohe.
Doch erhält Ästhetik ihren "Mehrwert" vor allem dadurch, daß sie auf "ein anderes" (Ethik, Moral, Humanisierung) transzendiert. Friedrich Schiller spricht von der Schaubühne als einer moralischen Anstalt. Der im deutschen Idealismus entwickelten Ästhetik liegt die Hoffnung zugrunde, daß der sublimierende Formtrieb die rohe Stofflichkeit zu überwinden vermag, daß der in der Sinnlichkeit der Kunst zutage tretende Vor-schein der Idee den Menschen zur Schöngutheit zu erziehen vermag. Indem Ästhetik auf Gesellschaft hin sich entgrenzt, Kultur ihrer sozialen Dimension gewahr wird (Soziokultur), vermeidet sie Regression in die Einseitigkeit des Schönen, ermöglicht sie Progression in Richtung des "Guten, Schönen und Wahren" - natürlich die Konfrontation mit der häßlichen, bösen, gewalttätigen Welt einschließend. Dies aber ist für den Neo-Ästhetizismus, der mit dem L'art-pour-l'art-Prinzip kokettiert und sich vor allem dem "Erhabenen" überantworten will, eine unerträgliche Belastung; das rein Artifizielle ist "in". Mit der Idee des Sozialismus sei auch engagierte Kunst und Kultur aufzugeben; Genuß ohne moralische Intentionen bedeute erst wahren Genuß. Deprimierend aufschlußreich, was im Literaturstreit (um Christa Wolf) ein anderer, der Anti-Gesinnungsästhetiker Frank Schirrmacher von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, schrieb, daß die westdeutsche Literatur als Sonderfall der europäischen Literaturgeschichte nun am Ende angelangt sei. Genötigt von einer sich schuldig fühlenden Gesellschaft zu bessern, zu belehren, zu erziehen und aufgefordert, ein demokratisches Bewußtsein zu beweisen, habe sie nun ausgedient.
Der neue Ästhetizismus ist vor allem deshalb gesellschaftlich und politisch gefährlich, weil er mit seiner Forderung auf eine scheinbar unpolitische, entpolitisierte, entgesellschaftlichte, jeder Instrumentalisierung sich entziehende Kunst die Fassade aufbaut, hinter der sich neue Blutrünstigkeit formieren kann. Oft propagiert die gleiche Person beides. Kunst um der Kunst willen und blutige Abrechnung. In seinem Artikel "Deutsche Revolution und protestantische Mentalität" bemerkt Karl Heinz Bohrer einleitend: "Das Beste, das ich bisher über das deutsche Dilemma las, stammt von einem französischen Intellektuellen: Nach einer Gewaltherrschaft sollten die Säuberungen "danach kurz und blutig sein", schreibt Joseph Rovan und fährt begründend fort: Blutig, weil mit den Mitteln des Rechtsstaates das Erbe an Haß, Wut, Entrüstung und Verachtung nicht bewältigt werden kann, das die Tyrannei materiell und psychisch hinterläßt, und weil Terrorperioden, die aber so kurz wie möglich sein sollten, den nicht zu vermeidenden Übergang zur Amnestie erleichtern. Diesen braucht die Gesellschaft besonders dann, wenn die Gewaltherrschaft so lange gedauert hat, daß von den Bürgern nur wenige nicht in irgendeiner Weise kompromittiert, einbezogen, mitschuldig gemacht worden sind. Der blutige Aspekt der `Säuberung' ist eine Art von Kollektivopfer, mit dem die Götter versöhnt werden sollen wie die `Kinderopfer einst in Karthago'." (Bohrer 1992a: 959)
Karl Heinz Bohrer identifiziert sich so (zunächst noch zitatologisch) mit politischer Unkultur, die den jahrzehntelangen, insgesamt durchaus erfolgreichen Bemühungen der Bundesrepublik um Rechtsstaatlichkeit hohnsprechen:
* Die Mittel des Rechtsstaates werden als ungeeignet bezeichnet, aber nicht nur das positive Recht ist damit gemeint, auch das Prinzip der Gerechtigkeit wird abgewertet. Ist Gegengewalt als ritualistischer Befreiungsschlag erfolgt, beendet Amnestie, die eine differenziert-abwägende Beurteilung nicht braucht, die blutige Ab rechnung (zumindest bis zur nächsten Säuberung).
* Der blutige Aspekt der Säuberung wird als "eine Art Kollektiv opfer" bezeichnet; mag man das auch inhaltlich nicht voll verste hen, der Sprachgestus verhilft sicherlich denjenigen, die sich zwar von aufgeklärter Moral gelöst haben, aber noch Skrupel zeigen, über solche Hemmnisse hinweg.
* Das leere Pathos der Rede von der Säuberung als Kollektivopfer wird nochmals gesteigert: Die Götter sollen dadurch versöhnt wer den; der "Abendland GmbH", die ansonsten den christlichen Gott für sich reklamiert und instrumentalisiert, ist in solchen Zusammen hängen der antike Polytheismus recht und billig.
* Die Säuberung als das mit den Göttern versöhnende Kollektivopfer wird schließlich den "Kinderopfern einst in Karthago" gleichge setzt; das zeigt in besonders erschreckender Weise, wie besinnungs und bewußtlos das heroische Pathos eines solchen metapherösen Stils selbst von der eigenen Klientel hinwegträgt; denn diese hat ansonsten doch mit ihrem "Jargon der Eigentlichkeit" das "Gute, Schöne und Wahre" usurpiert und eine an sich ergreifende ideali stische Trias im Rahmen affirmativer Kultur zwar auf eine nichts sagende Leerformel heruntergeredet, aber immerhin noch als Ma trize verfügbar.
"Seien wir uns mit Stolz der großen Schicksalszeit bewußt, die uns mit den Vätern gemeinsam ist. Aber setzen wir uns als Generation von ihnen ab. Die Zeiträume, die wir durchlebt und durchkämpft haben, bedingen, daß wir auf andere Weise wollen müssen als sie, auch wenn wir dieselben Ziele wollen. Scheiden wir uns von den Reaktionären ebenso wie von den Romantikern, Utopisten und Weltverbesserern - sie leben nicht in unserer Zeit. Wirken, das Notwendige wollen - das, was das Schicksal will - können wir nur in unserer Schicksalszeit. Mag sie hart sein, häßlich oder böse - wir bejahen sie, wie der Sämann den Acker bejaht. Wo sollen wir denn zu Hause sein, wenn wir in ihr nicht zu Hause sind? Aller Hader mit einer Zeit, in der man lebt, ist nichts als ein Eingeständnis der eigenen Schwäche. Sorgen wir dafür, daß unsere Zeit, und keine andre die gültige ist!" (Jünger 1927: 77)
Angesichts der zentralen Bedrohung demokratischer Kulturpolitik durch einen neu aufsteigenden "heroischen Ästhetizismus" erscheint Christo als höflicher und sympathischer nichtssagender Künstler. Was er theoretisch postuliert - daß es darum ginge, die uns immer mehr umstellenden Banalitäten und Trivialitäten mit Hilfe von Verfremdung aufzubrechen -, geriet beim Bonner "leidenschaftlichen Streit" um Kunstfragen zur Affirmation der Malaise: bestätigte nämlich die den Parlamentarismus immer mehr gefährdende Unfähigkeit, Wesentliches zu erkennen. Christo mag sie nicht, aber er befördert sie: Eng-stirnigkeit.
Christo will eine Kunst ohne Fesseln. Erfreulicherweise geht umwickelten Gebäuden nicht der Atem aus. Wer aber meint, daß diejenigen, die um Christo, gegen ihn, für ihn stritten, dann - wenn das Lehrstück als Enthüllung der Verhüllung erfolgreich zu Ende gebracht ist - geistig entfesselt wären, dürfte sich täuschen: Die Ablenkungsnischen bleiben kommod. 1949 meinte man, wenn man nach Berlin ziehen könne, und nicht nach Bonn müsse, würde sich Thomas Manns Wort, das er am 10. Mai 1945 über BBC ans deutsche Rundfunkpublikum richtete, bewahrheiten: "Deutsch war es einmal und mag es wieder werden, der Macht Achtung, Bewunderung abzugewinnen durch den menschlichen Beitrag, den freien Geist." (Mann 1968) Damals bannten "Gegenstrahlungen" Ernst Jünger als Repräsentanten der verspäteten Nation.
Nun bald in Berlin anlandend, wird in unserem kreuzbraven Parlament gewiß kein ästhetizistisch-nationalistischer Größenwahn ausbrechen; lediglich die Bayern geraten gelegentlich, wie jetzt beim Biergartenstreit, in den Diskant. Bei Christo sollte jedoch unsere kulturpolitisch meist abstinente, dann plötzlich in die falsche Richtung loszügelnde Politik gewarnt werden: "... traue nicht flugs und allerdings, denn die Wolken haben nicht alle Wasser, und es gibt mancherlei Weise. Sie meinen auch, daß sie die Sache hätten, wenn sie davon reden können und davon reden. Das ist aber nicht, Sohn. Man hat darum die Sache nicht, daß man davon reden kann und davon redet. Worte sind nur Worte, und wo sie so gar leicht und behende dahinfahren, da sei auf Deiner Hut, denn die Pferde, die den Wagen mit Gütern hinter sich haben, gehen langsameren Schrittes." (Matthias Claudius: ??)
Bohrer, Karl Heinz 1992a: Die Grenzen des Ästhetischen, in: DIE ZEIT vom 4. September 1992
Bohrer, Karl Heinz 1995: Die Kunst der Schleife, in: Merkur, Nr. 553
Bohrer, Karl Heinz 1995a: Hommage an das abenteuerliche Herz, in: Merkur, Nr. 553
Claudius, Matthias o.J.: An meinen Sohn Johannes, in: Gedichte, Werke, hrsg. von Roedl/Urban, Stuttgart
Jünger, Ernst 1923: Revolution und Idee, in: Völkischer Beobachter vom 23/24. September 1923, zitiert nach Reimann/Haßel
Jünger, Ernst 1925: Der Frontsoldat und die innere Politik, in: Die Standarte, Nr. 13 vom 29. November 1925, zitiert nach Reimann/Haßel
Jünger, Ernst 1926: Vorwort zu Friedrich Georg Jünger: Aufmarsch des Nationalismus, Leipzig
Jünger, Ernst 1927: Die Schicksalszeit, in: Arminius, Nr. 8, zitiert nach Reimann/Haßel
Jünger, Ernst 1930: Über Nationalismus und Judenfrage, in: Süddeutsche Monatshefte, 27 Jg., zitiert nach Reimann/Haßel
Mann, Thomas 1968: Deutsche Hörer! Fünfundfünfzig Radiosendungen nach Deutschland, in: Werke. Das Essayistische Werk. Taschenbuchausgabe in 8 Bdn., hrsg. von Hans Bürgin, Band 3: Politische Schriften und Reden, Frankfurt/M.
Reimann, Bruno W./Haßel, Renate 1955: Ein Ernst-Jünger-Brevier. Jüngers politische Publizistik 1920-1933. Analyse und Dokumentation, Marburg
Sontheimer, Kurt 1962: Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik, München
Welsch, Wolfgang (Hrsg.) 1993: Die Aktualität des Ästhetischen, München
