Ich sehe was, was Du nicht siehst!
Eine Person geht durch einen Raum und nichts passiert. Eine andere Person geht
durch einen Raum, während eine dritte ihr zusieht, und es ist Theater. Ein
Gebäude wird mit Folien bespannt, vielleicht um den Staub aufzufangen, der
bei Bauarbeiten entsteht, und nichts passiert. Ein anderes Gebäude wird
mit Folien bespannt, mit Sicherheit nicht, um irgendwelche Bauarbeiten
ungehindert ausüben zu können, und es ist Kunst.
Dem Phänomen, das aus "alltäglichen" Handlungen ästhetische
Prozesse werden läßt, versucht dieser Aufsatz nachzuspüren. Der
Unterschied zwischen den beiden Männern, die durch einen Raum gehen, liegt
im Blick des Betrachters. Der Raum, der jeweils durchquert wird, ist beliebig.
Es kann sich um eine institutionalisierte Theaterbühne handeln, es kann
sich aber auch um eine Fußgängerunterführung oder irgendeinen
anderen Platz handeln. Entscheidend ist der Betrachter, der diesen Vorgang als
theatral begreift. Theater ist notwendig eine öffentliche und eine
kommunikative Kunst. Der Zuschauer ist nicht nur ein applaudierendes
Anhängsel, der aus finanziellen Gründen dazugebeten wird, sondern er
ist konstitutierender Bestandteil eines jeden theatralen Prozesses. Was bei
Kleist noch Aufschrei des Entsetzens war - "Wenn alle Menschen statt der Augen
grüne Gläser hätten, so würden sie urteilen müssen,
die Gegenstände, welche sie dadurch erblicken, sind grün - und nie
würden sie entscheiden können, ob ihr Auge ihnen die Dinge zeigt, wie
sie sind, oder ob es nicht etwas hinzutut, was nicht ihnen, sondern dem Auge
gehört." (Kleist 1986: 200) -, wird der Avantgarde zum Spielgegenstand:
die subjektive Wahrnehmung. Der Blick des Rezipienten ist frei. Er wird
beispielsweise nicht durch Schnitte oder Kameraeinstellungen gelenkt, sondern
er kann umherschweifen. Der Blick kann verweilen oder weitereilen, die
Bühne ermöglicht es ihm, sich auf verschiedene Punkte zu
konzentrieren. Auch das Wegsehen ist möglich. Das Auge des
Theaterbesuchers komponiert sich die Bilderfolge selbst. So kommt es, daß
Theater zwar ein kollektives Erleben bedeutet, aber jeder einzelne seine
subjektive Sicht behält.
"Die Ästhetik, welche das Theater verwirklicht, ließe sich
vielleicht am angemessensten als "Ästhetik der Unterbrechung" kennzeichnen
und beschreiben. Der frei durch den Raum schweifende Blick des Zuschauers
hält plötzlich inne, verharrt bei einer Geste, einem Blick, einem
Lichtstrahl, einem Farbfleck, einem Gegenstand, ehe er seine Wanderung wieder
aufnimmt. Der Weg seines Blicks ebenso wie dessen Haltepunkte und ihre Dauer
werden von der Interaktion des auf der Bühne präsentierten Materials
mit seinem je individuellen subjektiven Wahrnehmungs-, Erinnerungs- und
Phantasievermögen, mit seiner besonderen Bedürfnisstruktur bestimmt."
(Fischer-Lichte 1993: 433)
Zeigt her Eure Füße, zeigt her Eure Schuh
Ihren Austausch von Beziehungsproblemen unterbrechend, werfen zwei Passanten
für eine kurze Weile einen Blick in das Schaufenster eines
Schuhgeschäftes. Es ergibt sich eine Meinungsverschiedenheit über die
ausgestellte Ware. Versuche, den anderen von der Schönheit bzw.
Unmöglichkeit eines bestimmten Schuhmodells zu überzeugen, scheitern.
Letztlich schließt der eine, der vergeblichen Diskussion müde:
"Irgendwie sind Schuhe auch nur Projektionsflächen."
Und dann fliegt der Schuh durch den Raum, und man weiß nicht unmittelbar
warum. Das Aufschlagen des Requisits auf dem Bühnenboden wird von einer
Toneinspielung in den Zuschauerraum, einem lauten Klirren, begleitet. Und
dieser Vorgang ist wiederum Impuls für weitere gleichzeitige und
aufeinanderfolgende Vorgänge (z. B. eine Lichtveränderung).
Unmöglich, die gesamte Zeichenfülle dieses theatralen Ereignisses
wahrzunehmen. Man befindet sich in der Theaterinszenierung "Die Sanfte" (1994)
von Robert Wilson. Auch die sprachlichen Elemente in dieser Inszenierung dienen
in erster Linie dem theatralen Spiel. Kein Drama liegt diesem Theaterabend
zugrunde, das illustrativ und linear umgesetzt würde. Lediglich
Sprachmaterial enthält diese Aufführung. Die Repliken in deutscher,
französischer und englischer Sprache bilden ein rhythmisches Klanggebilde
- beispielsweise durch die Wiederholung bzw. Variation eines gleichen Satzes
durch eine andere der drei Sprachen -, das in keinem eindeutigen
Bedeutungszusammenhang zu den anderen verwendeten Zeichensystemen steht.
"Dasein, nicht Bedeuten, ist das oberste Prinzip der Wilsonschen
Schaubühne." (Pfister 1988: 458) An dieser Reduktion des komplexesten
Zeichensystems des Menschen, der Sprache, auf seine materielle Oberfläche
wird deutlich, wie wenig oder gar nicht es in dieser Theaterform auf die
Vermittlung rational-diskursiver Inhalte oder Botschaften ankommt. Wilson
selbst sagt zu seiner Theaterarbeit, er wolle damit "eine Art optische[r]
Musik" erzeugen (Wilson in: Barck 1993: 372). Das Zeichenmaterial in Robert
Wilsons Theater wird desemantisiert, indem das Ausstellen der Materialität
der verwendeten Zeichen in den Vordergrund gestellt wird. In diesem Sinne ist
Wilson sozusagen ein "ungleicher Bruder" Christos: Wilson verhüllt zwar
keine bestehenden Bedeutungssysteme, aber auch er nimmt ihnen den "semantischen
Kern", indem er konkrete Gegenstände in einen abstrakten Kontext stellt,
bis nur noch die Hülle eines Zeichens bleibt. (Bei Christo bleibt die
Desemantisierung temporär, da durch die abschließende
Enthüllung das Objekt in seinen ursprünglichen Bedeutungskontext
zurückgeführt wird.)
Im Rezeptionsprozeß kann nun etwas völlig Neues geschehen: "[D]em
Zuschauer [wird] die Möglichkeit eröffnet, die
Bühnenvorgänge - ähnlich wie seine eigenen Traumbilder - als
eine eigenartige, zunächst fremde Welt staunend wahrzunehmen, deren
Elemente wohl vertraut erscheinen, ohne sich jedoch miteinander zu einer
übergeordneten Sinneinheit verbinden zu lassen. Wenn der Zuschauer sich
auf die konkreten Gegebenheiten dieser Welt ohne Hast und ohne den Drang, allem
sofort eine Bedeutung beilegen zu müssen, einläßt, können
assoziative Verknüpfungen in ihm neue Erfahrungen auslösen und bisher
unbekannte Sinnpotentiale aufschließen." (Fischer-Lichte 1990: 286) Und
nie ist eine Antwort allein ausreichend oder erfüllend, um einen Moment
dieser Inszenierung zu fassen und auf den Punkt zu bringen. So können
beispielsweise die besagten Schuhe in der Aufführung unterschiedlichste
"Rollen" annehmen, je nach dem, welches Bild sich der Zuschauer von ihnen
macht. Sind die Schuhe bloße Schuhe, die in ihrer Sinnlichkeit zur Schau
gestellt werden? Wird ihnen vielleicht - einen kurzen Augenblick lang - eine
konkrete Bedeutung zugeschrieben, wenn die Bewegungen der drei männlichen
Hauptakteure für eine Weile den Anschein erwecken, als wären sie
Ballspieler, die sich den Ball (einen Schuh) zuwerfen? Oder handelt es sich bei
den Schuhen - verwegen assoziiert, es drehe sich bei den drei männlichen
Hauptakteuren um die veranschaulichende Aufteilung einer Figur in drei
unterschiedliche Darstellungen von Lebensabschnitten einer Biographie - gar um
ein Symbol für die verlorene Unbefangenheit des Mannes, dem seine "Sanfte"
abhanden gekommen ist, da doch der elfjährige Kinderdarsteller im
Gegensatz zu den beiden älteren Darstellern noch nicht die
"zivilisatorischen Fußumhüllungen" (Schuhe) trägt, also noch
natürlich und unschuldig ist? Und so weiter.

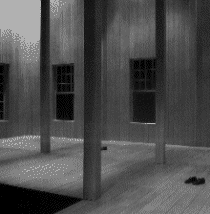


 http://www.kulturbox.de/christo/buch/maassen.htm (Einblicke ins Internet, 10/1995)
http://www.kulturbox.de/christo/buch/maassen.htm (Einblicke ins Internet, 10/1995)