
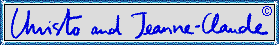
© 1995 by Christo & Luebbe Verlag
Chronologie des Reichstags-Projektes
1983

Verhüllter Reichstag, Projekt für Berlin
Collage, 1977
Hamburg, Sammlung G. Bucerius
Foto: Wolfgang Volz


 http://www.kulturbox.de/christo/chrono/1983___d.htm (Einblicke ins Internet, ~06/1995)
http://www.kulturbox.de/christo/chrono/1983___d.htm (Einblicke ins Internet, ~06/1995)
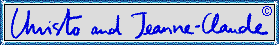
© 1995 by Christo & Luebbe Verlag

Verhüllter Reichstag, Projekt für Berlin
Collage, 1977
Hamburg, Sammlung G. Bucerius
Foto: Wolfgang Volz
Nicht nur in Bonn, auch in Berlin gerät einiges in Bewegung. Die Berliner F.D.P. möchte die Weizsäcker-Regierung nicht mehr nur tolerieren, sie möchte eine Koalition erreichen. Um dies zu ermöglichen, besetzt der Regierende Bürgermeister einige Senatorenämter um: Prof. Kewenig verliert dabei die Zuständigkeit für kulturelle Angelegenheiten an Volker Hassemer, früher für Stadtentwicklung und Umweltschutz zuständig. Was wird Rainer Barzels, was Hassemers Reaktion auf das Projekt sein? Kann er sich weiterhin auf Kewenigs Unterstützung verlassen? Wird Christo Barzel bzw. Hassemer sehen können?
Miami beschäftigt ihn, doch ab Herbst 1983 kann er sich wieder mehr Zeit für Berlin, für Paris, für andere Projekte nehmen. Er informiert sich. Prof. Kewenig besucht ihn in New York und erzählt, daß die Lage nach wie vor verworren sei; während sein Nachfolger, Senator Hassemer, dem Projekt eher abwartend gegenüber stehe, seien die Signale aus der Umgebung des neuen Bundestagspräsidenten durchaus hoffnungsfroh. Christo ist entschlossener denn je, das Projekt zu einem für ihn günstigen Abschluß zu führen.
Dennoch sei er vorsichtig: Er habe vor, eine Diätenerhöhung zu beantragen und brauche keine unnötigen Probleme; daher muß ein neuer Termin vereinbart werden, und zwar einer, der nicht im Büro des Präsidenten, sondern an einem neutralen Ort stattfindet.
Ein anderes Problem ist die Tatsache, daß Carstens Ablehnung vom 27. Mai 1977 Barzel bindet. Cullen überreicht Seidel die Kopie eines Briefes von Karl Ruhrberg, Direktor des Kölner Museum Ludwig, an Christo vom 22. Oktober 1980. Als Bundespräsident hat Carstens die Ausstellung "Mein Kölner Dom", für die Christo eine Collage von einem verhüllten Kölner Dom geschaffen hatte und die als Plakatsujet ausgewählt worden war, am 15. Oktober 1980 eröffnet. Dabei hatte er gesagt, daß er jetzt Christo die Genehmigung zum Verhüllen des Reichstagsgebäudes geben würde. Dieser Meinungswandel sei sogar durch die Presse gegangen. Seidel will Barzel den Brief sofort zeigen. Auch will Barzel wissen, was passieren würde, wenn die DDR gegen das Projekt Stellung bezöge. Volz antwortet, daß Christo nur die Teile des Reichstagsgebäudes verhüllen würde, für die er eine Genehmigung erhält; wenn die Verhüllung in vierzig Meter Höhe aufhöre, zeige dies auch eine Art Grenze, die der DDR nicht genehm sein könne. Seidel findet diesen Gedanken originell: die Mauer "im Kopf".
Volz muß abermals die Art der Finanzierung erklären; obwohl Seidel viel über das Projekt gelesen hat, weiß er noch immer zu wenig darüber. Dies ist wiederum eine Bestätigung, daß man über die Finanzierung niemals zu viel sagen kann. Tatsächlich werden nicht nur bis zur Genehmigung, sondern auch danach, immer wieder Argumente vorgebracht, die verraten, daß viele Menschen Christos und Jeanne-Claudes Projektfinanzierung nicht verstehen bzw. nicht verstehen wollen.
Es wird versucht, einen neuen Termin zu finden, November oder Dezember seien möglich, auch sei nicht ausgeschlossen, daß Barzel, wenn er um den 20. Januar 1984 New York besucht, Christo in seinem Atelier treffen könne.
Unmittelbar nach dem Treffen ruft Volz Jeanne-Claude an und schlägt vor, daß sie sich mit Winnie Wolff, der Ehefrau von Otto Wolff von Amerongen, die mit Barzel bekannt ist, in Verbindung setzen und ein gemeinsames Abendessen vorschlagen soll. Frau Wolff ist bereit, Barzel zu fragen, ob er eine Einladung zu einem solchen Dinner annehmen würde.
Im Bundestagsrestaurant hören Cullen und Volz von einem Parlamentsmitarbeiter, der sich in der Reichstagsverwaltung gut auskennt, daß der Reichstagsdirektor Heß noch nicht ganz für das Projekt schwärmt; man dürfe dies nicht auf die leichte Schulter nehmen; Heß würde gegen das Projekt Stimmung machen (dieser Eindruck bestätigt sich nicht).
Rosen erklärte ihm, daß es sich um Christos Reichstags-Projekt handele. Was würde die Sowjetunion dazu sagen? Herr Rodin antwortet, daß diese Frage die Sowjetunion überhaupt nicht interessiere; zwar verstehe man dort nicht, was der Künstler wolle, aber die ganze Angelegenheit gehe nicht die Sowjetunion, sondern ausschließlich die DDR an.
