
Seite 2 von 2
Volker Hassemer
Zur Architektur der Metropole und Bundeshauptstadt Berlin
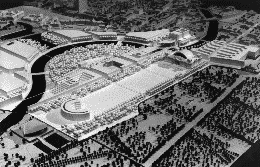
1. Preis im Wettbewerb "Spreebogen"
- Entwurf Axel Schultes
© Bundesbildstelle, Bonn

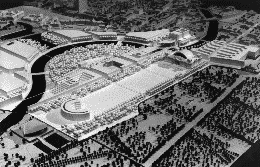
1. Preis im Wettbewerb "Spreebogen"
- Entwurf Axel Schultes
© Bundesbildstelle, Bonn
Bund und Berlin haben sich für die Erhaltung des ehemaligen Staatsratsgebäudes entschieden, das jetzt Sitz des Umzugsbeauftragten ist. Im Foyer steht das große Stadtmodell, in dem alle wichtigen Projekte der Innenstadt gezeigt werden, begleitet von einer Ausstellung zu den Planungen für die Hauptstadt.
Die planerischen Voraussetzungen für den Umzug von Parlament und Regierung bis zum Jahr 2000 sind also erfüllt. Der Rohbau des neuen Berlin steht. Er muß nun ausgebaut und vollendet werden. Mit dem Bundesbauminister und Umzugsbeauftragten der Bundesregierung, Herrn Dr. Klaus Töpfer, haben wir den Partner aus Bonn, mit dem wir dies nun umsetzen können.
Aus städtebaulicher Sicht kommt der Weiternutzung der historischen Regierungsbauten und der behutsame Umgang mit ihnen eine ganz besondere Bedeutung zu. Stellen sie doch zusammen mit Kulturgebäuden besondere Glanzpunkte in der Innenstadt dar. Dabei fügen sie sich in die über Jahrhunderte entwickelten Strukturen ein. Es ist gerade diese besondere Mischung der Funktionen, die der alten Berliner Mitte unverwechselbare Ausstrahlung gegeben hat.
Zwischen Brandenburg und Berlin ist die planerische Zusammenarbeit in den vergangenen vier Jahren in einer Weise gediehen, wie es in anderen deutschen Stadt-Umland-Situationen bei weitem nicht gelungen ist:
Wir haben für 1996 bereits eine gemeinsame Landesplanungsarbeit unserer zuständigen Ministerien verabredet; wir haben einen für beide Länder gemeinsamen Landesentwicklungsplan verabschiedet. Wir haben die Inhalte, aber auch die Grenzen der Siedlungsentwicklung kartographisch festgelegt, die für den Verflechtungsraum zwischen Berlin und Brandenburg Gültigkeit bekommen sollen. Das heißt, wir haben die Voraussetzung dafür geschaffen, daß die Stadtkante Berlins, der Übergang zu den attraktiven Landschafträumen in Brandenburg, erhalten bleiben kann.
Leitgedanke der gemeinsamen Planung mit Brandenburg ist die "dezentrale Konzentration". Hinter diesem Begriff verbirgt sich das Konzept, daß die Großstadt nicht in "Zwiebelringen" in das Umland hineinwuchert, sich kein "Speckgürtel" minderwertiger Nutzungen rund um die Metropole entwickelt; daß stattdessen dezentrale Entwicklungen in Brandenburg außerhalb des unmittelbaren Metropolenbereichs gestützt werden.
Doch nicht nur der historische Stadtkern, sondern auch die Randgebiete Berlins spielen für die Gesamtentwicklung und die städtebauliche Konzeption dieser Stadt eine große Rolle. Der Nordosten und der Südosten Berlins werden die wichtigsten Entwicklungsregionen in den nächsten 20 bis 30 Jahren sein. Dort, wo der größte Sanierungsbedarf besteht, bieten sich auch die besten Entwicklungsmöglichkeiten. Dort, im östlichen Teil unserer Stadt, werden wir in 20 bis 30 Jahren folglich nach all diesen Neuentwicklungen den modernsten Teil Berlins vorfinden.
In Erfüllung all dieser Aufgaben hat sich Berlin mittlerweile zu einer der größten Baustellen Europas entwickelt. Neben den privaten Investoren, die auf das Wachstum der Stadt setzen, tritt der Bund mit öffentlichen Mitteln in den kommenden Jahren als einer der größten Bauherren in Erscheinung. Sein städtebauliches und architektonisches Engagement wird mit unserer Unterstützung das Bild der Berliner Innenstadt nachhaltig verändern und prägen.
Begonnen hat die Entwicklung aber mit den Großprojekten der Investoren, am Potsdamer und Leipziger Platz. In weniger als einem Jahr wurde die städtebauliche Gestalt dieser beiden Plätze vom Senat beschlossen. Nun beginnt das Bauen. Dort werden Daimler Benz und Sony zentrale Einrichtungen ihrer Konzerne sowie Nutzungen für Einkauf, Wohnen, Kultur und damit ein lebendiges neues Stadtviertel mit Wohnungen und Arbeitsplätzen schaffen. Im Rahmen des städtebaulichen Konzeptes von Renzo Piano wird bereits seit einigen Monaten nach den Plänen so bedeutender Architekten wie Kollhoff, Isozaki, Rogers und Moneo auf dem Areal von Daimler Benz gebaut. Für das Areal vis-à-vis hat ABB den Entwurf von Giorgio Grassi ausgewählt. Sony entschied sich für ein Konzept von Helmut Jahn.
Die Mitte Berlins ist eine Ansammlung von höchst bedeutsamen Nachbarn: Regierung und Parlament, herausragende Institutionen aus Kultur und Wissenschaft, wichtige Vertreter von Handel und Wirtschaft finden sich hier gemeinsam an den besten Straßen und Plätzen, die Berlin zu bieten hat. Zwischen Potsdamer und Leipziger Platz, Spreebogen, Pariser Platz, dem "Forum Fridericianum", dem Lustgarten und der Museumsinsel ergibt dies eine Stadtlandschaft von höchstem Anspruch.
Ein kurzer Abriß sollte aber zeigen, daß dies nach alter Berliner Tradition nicht der einzige Raum ist, auf den man sein Augenmerk richten sollte. Berlin besteht aus vielen Orten, und die jetzt möglich gewordene Entwicklungsstufe soll sie alle in ihrer Unterschiedlichkeit stärken und profilieren.
Für das, was wir mit dem neuen Berlin verbinden, haben wir die erste Etappe erreicht. Es ist nicht nur die Vision von Berlin als Sitz von Regierung und Parlament, es ist die Vision von einer Großstadt im Einklang mit ihrem Umland. Eine Metropole, die ihren großstädtischen Zuschnitt im Inneren erst wieder zurückgewinnen muß, die aber zugleich ihre beispielhafte Ausstattung mit Landschaft, Natur und Wasser wahrt, ausbaut und sogar zur Richtschnur ihrer humanen Stadtqualität macht. Es ist die Vision der Nachbarschafts- und Verbindungsrolle, die wir in Mitteleuropa wahrnemen dürfen und müssen. Wir schaffen jetzt mit unserer Arbeit den Weg hin zu einem neuen Berlin: einer vielfältigen, kulturell hochaktiven Stadt mit dem politischen und ökonomischen, dem gesellschaftlichen Gewicht, das eine Stadt erreichen kann, die zu den ersten Hauptstädten Europas gehört.
Darüber hat für den Bereich der Stadtentwicklungsplanung das Stadtforum in fachlicher, intensiver und öffentlicher Diskussion in den letzten Jahren ein sicheres konzeptionelles Fundament vorbereitet. Ich hoffe sehr, daß die Architektur nun ihrerseits - Ort für Ort - dieser Vorlage gerecht wird. Dann ist mir nicht bange, daß wir in 20 Jahren selbstbewußt auf die Arbeit in dieser neuen Startphase Berlins zurückblicken können.
Auf allen Gebieten, der Luftreinhaltung wie der Abfallbeseitigung, der Wasserpolitik wie der Grünplanung, ist es uns gelungen, für die wiedergeeinte Stadt Konzeptionen zu finden, die ihre sichere Entwicklung nachhaltig garantieren.
Dies begann bereits mit der flächensparenden Strategie unseres Flächennutzungsplans, der in der Stadt und ihren Randgebieten nicht nur die grünen Areale sichert, sondern darüber hinaus sogar 16 zusätzliche Parks möglich macht.
In der spezifischen Umweltpolitik haben wir es geschafft, den Aufbau der neuen Konzepte mit der Entwicklung zukunftsweisender umweltpolitischer Methoden zu verbinden. Dazu gehört vor allem die größere Einbindung der Bürger in unsere Umweltstrategie. Das Bewußtsein der Bevölkerung erlaubt es inzwischen, mehr auf die Mitmachbereitschaft als nur auf den Gehorsam der Bürgerinnen und Bürger zu setzen.
So haben wir beispielsweise im Abfallbereich in zwei fachlichen Abfallforen eine sehr offene Erarbeitung unserer Konzepte praktiziert. Diese Konzepte setzen wiederum praktisch mehr als bisher auf den Beitrag der Berlinerinnen und Berliner selbst.
Nur so können wir unser Ziel der Halbierung der Abfallmenge erreichen. Nur so sind die nötigen und möglichen Recyclingaktivitäten zu erreichen. Eher mit dem Vorbild als dem Verbot, der Information als der Strafe - dies beschreibt den von uns beschrittenen Weg. Dieser Gedanke gilt auch verstärkt für unser Verhältnis zur Wirtschaft. Selbstverständlich werden wir die Grenzwerte zum Schutze unserer Umwelt auch in Zukunft benötigen. Um darüber hinausgehende Fortschritte zu erreichen, haben wir jedoch inzwischen über 150 Projekte kleinerer und mittlerer Betriebe unterstützt, die ganz konkret Wege eines umweltverträglicheren Wirtschaftens zum Ziel und Ergebnis haben. Bezeichnenderweise ist die Unterstützung der Europäischen Union, die wir für dieses Programm erhielten, eine der Struktur- und Technologieförderung.
Dies zeigt: Unsere Weiterentwicklung der Umweltinstrumente macht mehr als bisher Umweltschutz weniger zum Wirtschaftsbremser als zu einem wirklichen Wirtschaftsmotor.
Ich bekenne mich dazu, daß der jüngste Beschluß der Umweltministerkonferenz, bei Sommersmog nur saubere Autos (mit 3-Wege-Katalysator) fahren zu lassen, auf unsere Anregung zurückgeht. Das nämlich ist unsere Technikstrategie: Wir wissen, daß z.B. Geschwindigkeitsbegrenzungen gegenüber sauberer Technik sehr viel weniger für die Umwelt bringen. Also sollte die Umweltpolitik Anstoß für eine schnellere Verbreitung dieser Technik sein und zugleich am effektivsten das Smogproblem bekämpfen.
Wirtschaftsmotor sind wir aber auch in anderer Hinsicht. Dies belegen unsere Zahlen. Allein für die Wasserpolitik benötigen wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren Investitionen von rd. 20 Milliarden DM. Der größte Teil davon entfällt auf den Ausbau der Klärwerke und Klärschlammbeseitigung. Für die Altlastensanierung werden wir mindestens 3 Milliarden DM investieren, für unsere energiepolitischen Ziele stoßen wir Investitionen von 40 Milliarden DM an. Davon entfallen 6 Milliarden DM auf die Sanierung der Netze und den Neubau des Heizkraftwerkes Mitte durch die Bewag. Für unsere Abfallstrategie veranschlagen wir in den nächsten 10 Jahren eine Nachfrage in mindestens 2 Milliarden DM Höhe. Das sind zusammengenommen knapp 70 Milliarden DM. Der Schienenverkehr z.B. kommt mit einer Investitionssumme von rund 22 Milliarden DM hinzu.
Unser wirtschaftspolitisches Ziel muß es sein, diesen unerhörten Boom der Nachfrage zum Aufbau von Umweltindustrie in Berlin zu nutzen. Auch hier müssen wir sehen: So eine Chance wie jetzt bekommen wir nie wieder.
Es wird niemand wundern, daß solche Anstrengungen unserer Arbeit, die Umwelt zu verbessern, entsprechende Erfolge bescheren: In allen Bereichen unserer städtischen Umweltprobleme, sei es Luft, Wasser, Boden, Lärm oder Abfälle, gilt: Wir wissen, was wir tun müssen, wir haben die Strategien dazu entwickelt und wir haben mit der Arbeit begonnen. Diese Arbeit wird uns, was die Umwelt in Berlin angeht, auf eine langfristig sichere Seite bringen.
Die Arbeit meines Ressorts ist deshalb ein Spiegel der neuen Wege, der zu erwartenden Probleme, aber eben auch der ungeheuren Chancen, des Selbstbewußtseins und der Zuversicht, die jetzt zu Berlin gehören. Und sie ist auch insofern typisch, als wir in den letzten Jahren nicht Geschenke zu verteilen hatten - wohl aber die besonderen Entwicklungsmöglichkeiten des neuen Berlin eröffnet haben.
