
Seite 1 von 2
Volker Hassemer
Zur Architektur der Metropole und Bundeshauptstadt Berlin
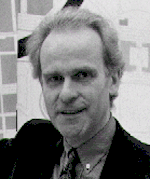

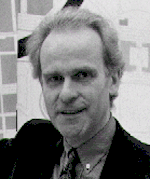
Dies bringt die Entwicklung auf den Punkt: Zu Beginn der Legislaturperiode diskutierte man darüber, was städtebaulich aus Berlin werden könnte. Heute wissen wir es, und der Wandel vollzieht sich bereits an vielen Ecken der Stadt.
Den Neubeginn von Parlament und Reichstag feiern wir in unserer Stadt in diesem Jahr mit dem Projekt eines der großen Künstler unserer Zeit, mit Christo. Das ist ein Glücksfall der Begegnung von Kunst, Politik und Architektur, noch dazu bei einem so wichtigen Anlaß. Mit der dauerhaften Wiedergewinnung des Reichstags für das Parlament der Bundesrepublik Deutschland wird ein weltweit eindrucksvolles und einmaliges Kunstprojekt verbunden sein.
Dieses großartige Projekt steht für die einzigartigen Herausforderungen, denen sich, sechs Jahre nach dem Fall der Mauer und fünf Jahre nach der Wiedervereinigung, die Architektur der Metropole Berlins stellen darf. Die städtebauliche, kulturelle und soziale Wiedervereinigung Berlins zu einer 3,5 Millionenstadt und die Umsetzung des Hauptstadtbeschlusses muß von einer Stadtgesellschaft geleistet werden, in der sich 40 Jahre lang getrennte Mentalitäten, getrennte Bedingungen individuellen und gemeinsamen Glücks entwickelten. Wir haben eine gemeinsame Zukunft, aber wir konnten uns auf ihre Herausforderungen nicht gemeinsam vorbereiten und gingen 1989 mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Fähigkeiten ans Werk. So haben wir mit der Einheit wichtige Pfeiler der früheren Wirtschafts- und Sozialpolitik diesseits und jenseits der Mauer in unserer Stadt verloren. Dabei durften wir nicht stehen bleiben. Aufbruch und Veränderung war und ist das Gebot der Stunde.
Inzwischen, mehr als fünf Jahre nach dem Fall der Mauer, haben wir das Stadium der planerischen Vorüberlegungen längst hinter uns gelassen. Der neue Wachstumsprozeß vollzieht sich und verändert sichtbar das Stadtbild. Die immense Aufgabenflut zwingt uns zu schnellen Entscheidungen, die Veränderungen erfordern Offenheit für Neues. Berlin ist heute ein Modell für den Um- und Weiterbau großstädtischer Strukturen. Denn so entscheidend wie unsere Stadt ist kaum eine andere Metropole zur Neudefinition ihres Stadtinnern aufgerufen.
Es sind jedoch nicht beliebige neue Entwicklungen, nach denen wir suchen. Sie müssen erkennbar "aus Berliner Boden wachsen". Und dies wiederum heißt, daß wir bei allem Voranschreiten uns sorgfältig und mit Engagement um den uns überlieferten Reichtum der Stadt an Architektur und Struktur kümmern müssen.
Deshalb bin ich sehr froh, daß mir gerade in dieser Zeit eine neue Fundierung des Denkmalschutzes für Berlin gelungen ist. Das neue Denkmalschutzgesetz, um das wir uns seit Jahrzehnten bemühen, vereinigt nicht nur alle Disziplinen des Denkmalschutzes in einer Hand, es bringt auch die Denkmalpflege in die Offensive, indem durch die Unterschutzstellungen im Listenverfahren umfassend über die insgesamt 7.000 Denkmalpositionen nunmehr gültig informiert werden kann. Dieses Ergebnis hilft uns, die neue Phase unserer Stadt sorgfältig aus ihrer Historie, aus ihren besonderen Attraktivitäten, aus ihren charakteristischen Eigenheiten heraus zu entwickeln.
Das Großartige an Berlin ist seine städtische Vielfalt. Die Stadtentwicklungspolitik muß diese Qualität stärken und sie in den Dienst der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger stellen. Das heißt, wenn wir in dieser Stadt bauen, müssen wir das nach dem Maß ihrer Tradition, ihrer Erfahrung, ihrer Möglichkeiten und nach den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner und ihrer Gäste tun. Wir wollen eine Stadt bauen, die ihren Bürgern Heimat bietet, wo sie sich zu Hause fühlen, und auf die sie gemeinsam stolz sein können.
Wir haben die letzten Jahre nach der Wiedervereinigung genutzt und alle stadtentwicklungspolitischen Entscheidungen getroffen, die unsere Stadt auf die Chancen dieser neuen Zukunft vorbereiten. Dokument dieser Arbeit ist vor allem der Flächennutzungsplan, der nach nur fünf Jahren Vorbereitung und intensiver öffentlicher Diskussion am 1. Juli 1994 in Kraft getreten ist.
Damit existiert endlich ein für das gesamte Territorium der Stadt rechtsgültiges Planungsinstrument. Der Flächennutzungsplan wahrt das grüne Berlin, sichert und fördert die spezifische und ungewöhnliche Vielfalt der Stadt. Der Plan entwirft außerdem eine moderne Strategie für Berlin als Arbeitsort und weist zahlreiche attraktive Wohnungspotentiale aus. Das Ziel und die Dimensionen der Hauptentwicklungsräume im Nordosten und Südosten Berlins sind definiert; wir arbeiten mit den Bezirken bereits an der Umsetzung.
Der Bedarf ist hoch: Bis zum Jahr 2010 könnte die Bevölkerung Berlins um rund 300.000 Einwohner auf dann 3,7 Millionen Menschen anwachsen. Damit einher geht ein Bedarf von etwa 400.000 neuen Wohnungen und Gewerbeflächen in einer Größenordnung von 500 ha zusätzlich zum Bestand und von Büroflächen von etwa 11 Millionen qm. Unser Konzept ist es, den Wohnanteil vor allem in der Innenstadt zu sichern und zu verstärken, insbesondere um die damit verbundenen Vorteile einer urbanen Mischung zu erhalten und der verödenden Entwicklung geschlossener Büro- und Verwaltungsareale entgegenzuwirken.
Unsere Planungen für den Arbeitsort Berlin betreffen nicht nur den zusätzlichen Bedarf für Gewerbe und Industrie sowie die unter Umständen zu erwartende Verdopplung der Büroflächen. Es geht auch um Strategien zur Schaffung von Produktionsarbeitsplätzen in der Stadt. Wir müssen uns dabei um solche Produktion kümmern, die "großstädtisch" ist, vor allem, weil sie von der Nachbarschaft zu Wissenschaft und Kultur profitiert, von dem also, was gerade eine Großstadt, die sich ja ansonsten eher problematisch für Umwelt und Industrie erweist, zu bieten hat. Der Entwicklungsbereich Adlershof im Südosten Berlins ist dafür das beste Beispiel. Dort wollen wir die naturwissenschaftichen Fakultäten der Humboldt-Universität, zentrale Forschungsinstitutionen, gutes Wohnen und Erholung auf 465 ha zusammenbringen.
Nicht minder wichtig ist die Lokalisierung der Büroflächen an Orten, wo sie die Stadt beleben und profilieren und nicht dominieren. Diese Flächenpotentiale finden wir in ihrer Großentwicklung entlang des inneren S-Bahnrings, vor allem an den vier Schienenkreuzungspunkten von Radialen und Ring.
Mit den bisher abgeschlossenen Wettbewerben wird eine Investitionssumme von ca. 53 Milliarden DM erwirtschaftet. Dies bedeutet: Wir werden in den nächsten 10 bis 15 Jahren mindestens 270.000 neue Arbeitsplätze durch die Arbeit der Stadtplanung ermöglichen. Allein in die Grüngestaltung der Stadt werden übrigens bis zum Jahr 2010 3,5 Milliarden DM fließen und etwa 30.000 Arbeitsplätze geschaffen werden.
Einer der wichtigsten Aspekte für die zukünftige Entwicklung der Metropole Berlin war die Entscheidung des deutschen Bundestages vom 20. Juni 1991, den Sitz des Parlaments der Bundesrepublik Deutschland nach Berlin zu verlegen. Am 3. Juni 1992 folgte dann der Umzugs-Beschluß der Bundesregierung, in Berlin ihren Sitz zu nehmen. Wir haben seitdem in kürzester Zeit riesige Schritte bewältigt. Parlament und Regierung werden überwiegend in vorhandene Gebäude ziehen. Diese alten Gebäude haben fast alle Denkmalqualität.
