
Seite 2 von 3

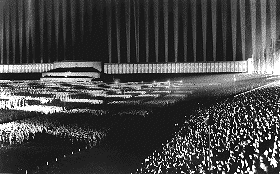
NSDAP-Parteitag 1936
© Ullstein Bilderdienst
Nationalismus und Chauvinismus liegen jedoch nahe beieinander, sie stellen nur verschiedene Stadien eines Entwicklungsprozesses dar, und es ist noch nicht ausgemacht, daß das eine ohne das andere dauerhaft bestehen kann. So erscheint den einen die erste Strophe der deutschen Nationalhymne "Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt ... Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt" als ein harmloses Lied ohne jede politische Bedeutung, während die anderen, insbesondere unsere unmittelbaren Nachbarn, fürchten, daß die Deutschen erneut danach strebten könnten, alle Gebiete, in denen deutsche Stämme sich in früheren Zeiten niedergelassen haben, in einem deutschen Großreich zu vereinen. Auch die Krönung des Preußenkönigs Wilhelm zum deutschen Kaiser war ein symbolischer Akt von Chauvinismus. Die Krönungszeremonie fand bekanntlich nicht auf deutschem Boden statt, sondern auf dem Boden des geschlagenen Gegners Frankreich. Im Spiegelsaal von Versailles, dem Schloß der französischen Könige, wurde mit dem Festakt zugleich die Erbfeindschaft zwischen Deutschen und Franzosen besiegelt. Seither sind den Verlierern mit besonderer Kreativität auf beiden Seiten jeweils Demütigungen dieser Art bereitet worden.
Es scheint so, als ob - mit wenigen Ausnahmen - die Bildung neuer Nationalstaaten wiederum zur Bildung von ethnischen Minoritäten führt, die unter Umständen ihrerseits nach einem eigenen Staat streben. Offenbar bedarf der Nationbegriff einer näheren Untersuchung. Michael Ignatieff hat hierzu eine Differenzierung vorgenommen, die zu einer Klärung des schwierigen Verhältnisses von Nation und Nationalstaat beitragen könnte. Er unterscheidet nämlich zwischen ethnischem und zivilem Nationalismus und dem jeweils dazu gehörenden Nationbegriff. Beruht die ethnische Nation auf ethnischer Homogenität, so ist die zivile Nation eine Gemeinschaft von gleichen, (grund-) rechtsfähigen Bürgern, die - unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Glauben, Geschlecht, Sprache oder ethnischer Zugehörigkeit - "in patriotischer Treue zu einem von allen geteilten Grundbestand politischer Vorgehensweisen und Werte" vereinigt sind (Ignatieff 1993: 3 f.). Da hier die Souveränität beim Volk liege, sei die zivile Nation notwendigerweise eine demokratische Gemeinschaft. Während sich nun der zivile Nationalismus mit der Französischen und der Amerikanischen Revolution anschickte, die Welt zu erobern, blieb Deutschland - neben den slawischen Ländern - ein Beispiel für den ethnischen Nationalismus, den die Nazis mit dem Motto "Ein Reich, ein Volk, ein Führer" auf die Spitze trieben.
Es scheint so, als ob diese explosionsartigen Abwehrhandlungen aus der (unbewußten) Angst vor dem Verlust der eigenen bzw. der kollektiven Identität herrührten. Denn auch die Staatsbürgerschaft, die in der deutschen Diskussion um angemessene Lösungsmöglichkeiten eine zentrale Rolle spielt, ändert offenbar an dem Grundkonflikt, das Eigene durch das Fremde bedroht zu sehen, wenig oder gar nichts. In Großbritannien wie in Frankreich gilt bekanntlich das Jus Soli, d.h. jedes Kind, das auf dem Territorium des Staates geboren wird, erwirbt damit automatisch die Staatsbürgerschaft, während in Deutschland das Jus Sanguinis gilt, demzufolge das Kind mit der Geburt stets die Staatsbürgerschaft der Eltern erwirbt. Zumindest vor dem Gesetz sind damit Briten indischer oder afrikanischer Abstammung, die Nachfahren der angelsächsischen oder normannischen Einwanderer und die keltischen Ureinwohner gleich. Und auch die Franzosen algerischer, vietnamesischer oder afrikanischer Herkunft haben theoretisch die gleichen Rechte wie ihre gallischen Landsleute. Und dennoch kommt es in England regelmäßig zu Rassenkravallen, und in Frankreich machen rechte Fanatiker Jagd auf die "Beurre", junge Franzosen, deren Vorfahren aus Nordafrika stammen.
