
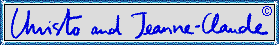
© 1995 by Christo & Luebbe Verlag
Chronologie des Reichstags-Projektes
März - April 1977

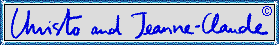
© 1995 by Christo & Luebbe Verlag
Als der Film zu Ende geht, beginnt Cullen mit einer kurzen Rede, in der er die Vorstellungen von Christos Mannschaft entwickelt. Karl Ruhrberg hält einen ausführlichen Vortrag. Wibke von Bonin erklärt, wie wichtig die Medien seien und daß sie in ihrer Sendeanstalt, dem WDR, dazu beitragen werde, daß das Projekt realisiert werde. Christo sagt, warum er das Reichstagsgebäude und Berlin gewählt habe, daß es aufregend wäre, wenn das Projekt in Berlin zustande käme. Bundestags-Vizepräsidentin Annemarie Renger erscheint. Frau Funcke wirft ein, sie habe Bedenken, daß die Deutschen mit einer solchen Kunst nichts anzufangen wüßten, und sie schlägt vor, vielleicht erst einmal die Verpackung des Hermannsdenkmals im Teutoburger Wald vorzunehmen, damit sich die Deutschen an Christos Kunst gewöhnen könnten. Sie habe auch Angst, daß Demonstrationen vor dem Reichstagsgebäude stattfinden könnten, die dann denjenigen von Brokdorf ähnelten. Herr Raue entgegnet, der Vergleich hinke, weil das Atomkraftwerk Brokdorf als potentielle Gefahr für die Öffentlichkeit angesehen werde.
Carstens sagt dann, daß er als Privatperson das Projekt sehr wünsche, er müsse es aber auf seine politische Vertretbarkeit prüfen. Frau Renger sagt: "So ist das also, Sie finden das gut; also ich finde, daß wir das Projekt unbedingt wagen sollen, das ist eine große Chance für Berlin und würde ein interessantes Gespräch in der Öffentlichkeit ins Rollen bringen. Ich habe die Entscheidung mehrfach überlegt, Sie wissen, als ich Präsidentin dieses Hauses war, habe ich auch mit Christo gesprochen. Seitdem habe ich meine Meinung einige Male geändert, aber ich bin zu dem Schluß gekommen, daß es eine großartige Chance für Berlin ist." Carstens ist sichtlich von Frau Rengers Begeisterung überrascht und sagt, daß er ihr nur zustimmen könne, was die künstlerische Qualität des Projektes angehe. Als Cullen das Gefühl bekommt, die Sitzung gehe bald zu Ende, versucht er, zu etwas Konkreterem überzugehen, worauf Carstens antwortet, er würde sich in zwei Wochen melden. Carstens Antwort kommt etwas überraschend, denn Christo und Cullen können innerhalb von zwei Wochen nur einen negativen Bescheid erwarten. Die Sitzung ist beendet.
Lattmann und die SPD-Mitglieder des Kulturausschusses empfangen Christo am Nachmittag. Sie wollen wissen, was sie tun können, um das Projekt voranzubringen. Nach dieser Sitzung schreibt Christo an einer Erklärung für Petra Kipphoff, die in der nächsten Ausgabe der Zeit erscheinen soll.
Der entsetzliche Vorschlag taucht auf, ein ehemaliges Konzentrationslager zu verpacken. Christo erklärt, daß er nicht vorhabe, irgend etwas durch seine Verpackung anzuprangern, was ein Konzentrationslager eindeutig verdiene.
Der Pressedienst der Union erklärt, daß im Verlauf des Abends "eine leichte Tendenz für das Projekt erkennbar" geworden sei. Es herrsche weiterhin die Meinung, daß die Diskussion auf jeden Fall fortgesetzt werden möge; die Bedeutung für Berlin sei allen klar. Sie liege vor allem darin, daß das Projekt in der Lage sei, auf die besondere Situation Berlins, auf die geteilte Stadt, das geteilte Deutschland und das geteilte Volk aufmerksam zu machen.
Christo, Volz und Cullen fliegen nach Berlin, wo mehrere Pressegespräche und, durch Vermittlung von Christos Freund John Powers, eine Diskussion im Aspen-Institut organisiert werden. Abends fliegt Christo nach New York zurück.
Die Westfälischen Nachrichten schreiben am 18. März, daß Christos Vorschlag Carstens "Kopfzerbrechen" mache. "Es ist schwer vorstellbar, daß das Bundestagspräsidium einer solchen Scharfsinnigkeit des Künstlers widerstehen kann."
Nach der Bonner Woche ist Christo fest entschlossen, ein möglichst gutes Klima für die zu erwartende Entscheidung zu schaffen. Er gibt zahlreiche Interviews, vor allem in New York. Es erscheinen auch lange Presseberichte, dort und in Deutschland. Die Berliner Morgenpost meldet am 19. März "Bedenken" an: "Könnte nicht - angesichts der Grenze des für uns kaum noch Tragbaren - erklärt werden, unsere demokratische Grundordnung sei mit der geplanten Aktion reif zum Einpacken?" Am selben Tag erscheint in dieser Zeitung eine Karikatur. Sie zeigt eine Person, die eine Zeitung mit der Schlagzeile trägt: "Der Reichstag wird eingewickelt!" und ergänzt dies mit den Worten: "Und der Steuazahla ooch!" Sybille Wirsing schreibt in der FAZ am 22. März etwas unsicher: "Wenn auch das Bundestagspräsidium [das Projekt erlaubt], wird es also weitgehend von dem geistigen Auge des Betrachters abhängen, was man schließlich in Christos Veranstaltung sieht: Ein Fassadenkunststück, hinter dem die Historie stumm und abweisend zurücktritt, oder die Beschwörung der Geschichte durch die Institution eines Kunstwerks."
Die Morgenpost bringt am 24. März einen Kommentar mit dem Rat, Christo möge das sowjetische Ehrenmal in Westberlin verpacken: "Vielleicht mit rotem Nylon, aber für immer." Am 25. März erklärt sich Lieselotte Funcke gegen die Verpackung: "Es ist . die Frage, ob im Bewußtsein der Bevölkerung der geschichtliche und politische Sinngehalt des Reichstages . mit der Absicht einer auch nur zeitbegrenzten Verfremdung vereinbar ist. Ich meine, auch unter Berücksichtigung aller künstlerischen Aspekte ist dies nicht der Fall." Frau Funkes äußerung findet große Beachtung und wird in mehreren Dutzend Zeitungen abgedruckt, die äußerung von Annemarie Renger, die dafür ist, dagegen gar nicht.
Die Kampagne der Berliner Morgenpost geht weiter mit negativen Leserzuschriften am 29. März. Jemand schreibt: "Jenseits der Mauer . wird man sich vor Lachen biegen ob der Würdelosigkeit unserer Politiker." Bei Bundestagspräsident Carstens gehen viele Briefe zu dem Projekt ein, überwiegend negativer Art. Am 21. März erscheint im Spiegel ein langer Aufsatz von Jürgen Hohmeyer über die "Gralsburg an der Mauer". Der Aufsatz ist ausgewogen, sachlich und weitgehend positiv und schließt mit einem Appell: "Das Projekt ist eine Chance. Christo will ein prekäres Symbol deutscher Geschichte und Gegenwart unübersehbar in Frage stellen. Soll er." ähnlich ist der Tenor der Sendung in dem ZDF-Magazin Aspekte am 22. März. Das Fachorgan der Berliner Architekten Die Bauwelt spricht sich ebenfalls dafür aus. Am 1. April erscheinen eine Besprechung von Manfred Sack in der Zeit und eine Meldung im Berliner Tagesspiegel, daß Christo den Steglitzer Kreisel verpackt - daneben ist eine Zeichnung abgebildet. Beide Artikel erweisen sich als Aprilscherz.
Die Meinungsbildung setzt sich auch in Bonn fort. Associated Press und Newsweek erbitten Informationen über Christo. Der CSU-Politiker Hans Klein sagt, daß Richard Stücklen "nach wie vor" für das Projekt sei. Aus sicherer Quelle heißt es, daß eine Mehrheit im Präsidium für das Projekt sei. Ein Gespräch mit dem Chefredakteur der Berliner Morgenpost, Marquardt, zeigt, daß dieser vehement gegen das Projekt ist und alles abdruckt, um das Projekt zu verhindern. Christo möge die Freiheitsstatue verpacken. Befürworter des Christo-Projekts rufen an und sagen, daß ihre Briefe in der Berliner Morgenpost nicht abgedruckt würden. Der Hörfunk des WDR bringt die Sendung "Füttern erlaubt", die sich ausschließlich mit Christos Projekt beschäftigt. Die Hörer sollen ihre Ansichten telefonisch mitteilen, die dann von einem Computer noch während der Sendung ausgewertet werden. Als Alternative zur Verhüllung werden angeboten: die Koalition, die Opposition, die FDGO, Kernkraftwerke, die Medien, der Verfassungsschutz, Wanzen und die eigene Sendung. Als Material werden vorgeschlagen: salvatorischer Sichtbeton, Holzwolle, Gummitücher, Alufolie und Klosettpapier. 1121 Anrufe gehen ein. 60% sind für die Verhüllung des Reichstages, wie Christo es vorschlägt. 40% wären dafür, die Koalition, den Verfassungsschutz und Kernkraftwerke einzupacken. Klopapier überwiegt als Vorschlag für das Verpackungsmaterial.
Cullen verhandelt mit Vertretern der Alliierten Schutzmächte in Berlin und besorgt einen Termin für Christo für Ende Mai. Es wird vereinbart, daß Christo um den 20. Mai in Berlin sein wird. Am Abend der Abreise der Ausschußmitglieder nach New York gibt die BZ das Ergebnis einer Umfrage unter den Mitgliedern des Kunstausschusses bekannt. Dieses wird jedoch wie ein Fußballergebnis abgedruckt: "9:4 für Christo" und erweist sich als Bärendienst. Am 25. März wird im Radio eine Gesprächsrunde mit Vertretern der SPD, CDU und F.D.P. ausgestrahlt. Alle Anwesenden sprechen sich für das Projekt aus. In New York ist Christo so erkältet, daß er die Berliner Parlamentarier nicht persönlich empfangen kann. Jeanne-Claude zeigt ihnen das Atelier.
