
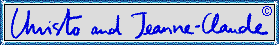
© 1995 by Christo & Luebbe Verlag
Chronologie des Reichstags-Projektes
1982
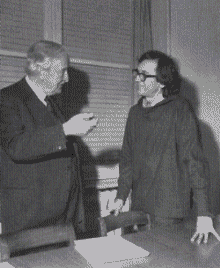
Christo mit dem Bankier Herrman Josef Abs,
Vorstandsmitglied des Städel
Museums in Frankfurt am Main
Februar 1982
Foto: Wolfgang Volz

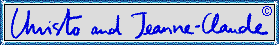
© 1995 by Christo & Luebbe Verlag
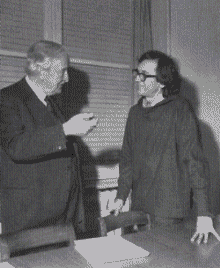
Christo mit dem Bankier Herrman Josef Abs,
Vorstandsmitglied des Städel
Museums in Frankfurt am Main
Februar 1982
Foto: Wolfgang Volz
Das Kupferstichkabinett ist überfüllt, und viele wollen wissen, ob Christo nicht das Bankenviertel oder die Startbahn West verhüllen möchte. Christo entwickelt seine Ideen, indem er sagt, daß es ihm nicht darum gehe, etwas zu verunglimpfen, indem er es verhüllt, und daß er die Problematik der Startbahn nicht kenne, weil Frankfurt sehr weit weg sei. Es kommt auch die Idee zur Sprache, Christo möge doch die Alte Oper verhüllen, die man im September 1981 nach vielen Jahren Wiederaufbauarbeit wiedereröffnet habe. Christo antwortet, daß Vertreter Frankfurts bei ihm in New York diese Frage vor Jahresfrist gestellt hätten; er mußte ablehnen. Frankfurt ist verwirrt - keiner weiß von dieser Initiative.
Bürgermeister Walter Wallmann sagt, er sei es nicht gewesen. Christo muß erneut erklären, daß es ihm nicht darum gehe, beliebige Häuser, so schön oder so häßlich sie sein mögen, welche Bedeutung sie auch hätten, zu verhüllen, daß er wahrscheinlich überhaupt kein anderes Gebäude verhüllen werde nach dem Reichstag und daß das Reichstagsgebäude das einzige Objekt in Deutschland sei, an dem er interessiert ist.
Hermann Josef Abs, Vorstandsmitglied des Städel, erklärt, daß er sehr wohl für die Realisierung des Projektes sei, daß er aber glaube, mit den meisten Leuten sagen zu können, daß es das beste wäre, man verhülle es und dann sehe man, was für eine Wirkung das habe. Abs findet starken Beifall in einem weitgehend mit Jugendlichen besetzten Saal. Am 3. Februar, vor der eigentlichen Eröffnung, geht Christo zur Architekturfakultät des Städelschen Kunstinstituts und spricht mit den Architekturstudenten. Bei der Ausstellungseröffnung hat er ein gutes Gefühl, daß das Projekt durch Hermann Josef Abs wieder ins Rollen gekommen sei. Abs lehnt es jedoch ab, auf Christos Einladung einzugehen und Mitglied des Kuratoriums zu werden. Er ist der Ansicht, daß er Christo viel eher helfen könne, wenn er dem Kuratorium nicht beitrete.
Wieland Schmied sagt, daß die Diskussion von dem Projekt nicht mehr abzutrennen sei. Für alle, die Berlin liebten, verknüpfe sich das Reichstagsgebäude immer mit diesem Projekt von Christo. Die Politiker hätten eigentlich viel besser daran getan, diesem Künstler dankbar zu sein, daß er das Gebäude wieder sichtbar hervorhebe, daß er die Aufmerksamkeit der gesamten Welt darauf zu richten wisse; es gebe kaum einen Künstler, dessen Werk "stärker auf Schönheit zielt" als dasjenige Christos. Heinrich Senfft sagt, daß das Haus "ein Stück ärgerlicher Erinnerung" sei, es sei ein nahezu "obszöner Gegenstand", wenngleich es als ein "Stück der Hoffnung, ein Mahnmal der Demokratie wieder sichtbar zu machen", wiederaufgebaut worden sei. Er glaubt, daß es eine sehr schlechte Idee gewesen sei, das Haus wiederaufzubauen, "zur Erinnerung an eigentlich nur grauenhafte Ereignisse". Er könne nicht finden, daß das ein besonderes Mahnmal der Demokratie gewesen sei, und abschließend sagt er: "Ich glaube, ein großer Teil der schmählichen Sachen, die sich in diesem Lande abgespielt haben, hat dort seinen Ausgang genommen." Daraufhin bekommt er lebhaften Beifall. Auch für Hajek verbindet sich das Gebäude "mit eigentlich nur grauenhaften Ereignissen": die Kristallnacht, Bücherverbrennung sowie das ganze Feuer in Europa. Der Reichstag ist für ihn ein ganz persönliches Erinnerungsstück und er möchte nicht erlauben, daß ein fremder Mensch an seiner Erinnerung verschlechternd oder verschönernd herumfuchtelt. Für Tilmann Fichter ist "das Haus eine Funktionsruine". Er tritt mit diesem Argument für die Verhüllung ein, weil er meint, eine Funktionsruine gehöre ebenso verhüllt wie die Berliner Kongreßhalle. Christo hat die Gelegenheit zu einer Erwiderung, um die ästhetischen Aspekte zu unterstreichen.

Diskussion im Künstlerhaus Bethanien in Berlin am 5. Mai 1982
Von links nach rechts: Tilmann Fichter, Otto Hajek, Heinrich Senfft, Michael Cullen, Christo, Jeanne-Claude,
Reinhold Schattenfroh, Wieland Schmied, Lore
Ditzen, Wilhelm A. Kewenig.
Foto: Wolfgang Volz
Reinold Schattenfroh fragt, ob die Überlegungen der Politiker, "ob mit einer solchen Verhüllung Gefühlswerte und Überzeugungen nicht verletzt werden", nicht berücksichtigt werden könnten. Kewenig schließt mit dem Argument, daß er diejenigen der anderen, der Gegner, verstehe und achte, aber dennoch sagen möchte, daß es nicht richtig sei, von dieser Aktion abzulassen. "Ich möchte allerdings eins mit aller Deutlichkeit sagen: Wenn man die Verpackung des Reichstages zu einer politischen Demonstration machen will, ... wie sie hier am Tisch in mehreren Beiträgen anklang, nämlich, verpacken wir doch das, was dieser Reichstag an Tradition symbolisiert, und machen dadurch deutlich, damit wollen wir mehr oder minder nichts mehr zu tun haben ." - das ginge nicht. "Ich würde sagen, je mehr man die Verpackung des Reichstags zu einer politischen Demonstration macht, um so unwahrscheinlicher ist, daß irgendein Politiker, gleichgültig, wo er meines Erachtens im politischen Spektrum steht, dieser Verpackung zustimmen kann." Er sagt auch, daß die Entscheidungen, die in diesem Hause stattgefunden haben, mögen sie gut oder schlecht, klug oder idiotisch gewesen sein, denjenigen der Parlamente in aller Welt ähneln, denn kein Parlamentsgebäude könne von solchen Bestrebungen und Ereignissen frei sein. Man könne aber auch wegen der Ereignisse im Reichstagsgebäude keine Rückschlüsse auf die Verpackungswürdigkeit ziehen.
Die Ausstellung in Berlin ist ein großer Erfolg, außerhalb der Stadt findet sie kaum Beachtung. Die Berliner Morgenpost ist mit einer Breitseite schnell zur Stelle: Kewenig sei eingewickelt, "Christos Plan ist in Berlin nicht willkommen". Andreas Kaps schreibt im Tagesspiegel:
1. Wird es Christo selbst gelingen, an diesem derartig symbolüberfrachteten Monument quasi summarisch ästhetische, >internationale< Erfahrungen umzusetzen, die dann auch dem künstlerischen Wert seiner jetzt schon seit Jahren dafür erarbeiteten Zeichnungen, Modelle und Entwürfe entsprechen?
2. Wird diese doch wahrscheinlich ästhetische Leistung dann auch nicht nur von Kunstliebhabern gleichsam professionell gewürdigt, sondern gehen die positiven und ideellen Kräfte aus ihrer Konzeption auch über ins kulturelle Bewußtsein oder Unterbewußtsein der Berliner Bevölkerung?
Die Verantwortung für das Gelingen einer solchen künstlerischen, kulturell und wohl auch politisch bedeutsamen Veranstaltung sowie deren Erfahrbarkeit als unsere Zeit verbesserndes Symbol liegt damit also nicht nur beim Künstler selber."
Aufgrund der Diskussion kommt ein Moderator des Senders Freies Berlin auf Cullen zu und fragt, ob Christo bereit wäre, an einer Fernsehdiskussion teilzunehmen. Cullen sagt, daß dies nur sinnvoll wäre, wenn gute Befürworter und gute Gegner dabei seien. Der Moderator, Justus Boehncke, stellt sich dann vor als derjenige, der bei dem Podiumsgespräch am 5. Mai 1982 eine Frage nach dem Geld gestellt hatte. Er habe bereits eine Liste von Befürwortern und Gegnern zusammengestellt, und sobald Cullen das Einverständnis von Christo erhalten hat, werden die Vorbereitungen getroffen. Diese Sendung findet dann in der "Arena"-Reihe am 15. Juni 1982 im Ersten Programm von 23.00 Uhr bis 0.30 Uhr statt. An dieser Sendung nehmen teil: der Moderator Boehncke, Christo, Senator Kewenig, Professor Uwe Wesel, Enno von Löwenstern, Bazon Brock und Cullen. Cullens Rolle ist, zur Verdeutlichung einiger historischer Probleme beizutragen. Christo selbst soll kaum etwas sagen oder tun, sondern mehr oder weniger als "Beleg" für die Sendung mit dabei sein.
Diese Diskussion zeitigt wiederum merkwürdige Konstellationen. Der zur Linken gehörende Jurist Uwe Wesel ist gegen das Reichstags-Projekt. Er sitzt neben dem zu den Konservativen gehörenden Journalisten Enno von Löwenstern, einem Leitartikler der Welt in Bonn. Sie mögen sich persönlich nicht und wollen nur widerwillig zur Kenntnis nehmen, daß sie beinahe die gleiche Einstellung haben, allerdings nur im Resultat, nicht in der Begründung. Uwe Wesel kann nicht sehen, daß die Verhüllung des Reichstages irgendwie behilflich sein könnte bei der Aufarbeitung der Faschismusfrage. Außerdem sei das Projekt viel zu bombastisch angelegt. Wenn Christo ein kleineres Projekt machen würde - dieses Argument hatte bereits Frau Funcke 1977 aufgebracht -, würde er vielleicht dafür sein. Löwenstern ist der Meinung, daß Christo keine Kunst, sondern Schau mache, daß das Reichstagsgebäude ein prekäres Symbol der Demokratie und die Verhüllung dem Gefühl für Demokratie und Geschichte abträglich sei. Christo hört der Übersetzung dieser Argumente ruhig und geduldig zu. Auf der anderen Seite plädiert Senator Kewenig für die Verhüllung - daß es überhaupt nicht deren Ziel sei, die Faschismusfrage aufzuarbeiten - ein sicherlich sehr wertvolles Ziel -, aber an dieser Elle alles menschliche Tun zu messen, würde vieles ausschließen; das alles seien "äpfel und Birnen". Bazon Brock ist ganz anderer Meinung als Herr von Löwenstern; das Haus habe niemals eine Beziehung zur Demokratie gehabt und es sei völlig gleichgültig, ob dort viel oder wenig Demokratie stattgefunden habe - nur Christos Projekt sei in der Lage, dem Symbolwert Adäquates zu bieten, es sei Christos Projekt, das die Diskussion in Deutschland ausgelöst habe. Dafür solle man ihm dankbar sein.
Christo selbst äußert sich am Anfang und am Ende der Sendung kurz, blättert zumeist in großen Kunstbüchern, in die er Faltenwürfe eingeklebt hat. Er hatte es abgelehnt, irgendeine Verhüllung, auch im kleineren, vor der Kamera durchzuführen, sondern nur einige Filmausschnitte seiner früheren Projekte für den Filmgeber mitgebracht.
Einige Tage später erscheinen mehrere Besprechungen. In der Morgenpost ein recht negatives Wort: "Wenn solche Diskussionen nicht so ernsthaft geführt werden würden, könnte man über sie lachen." Am Sonnabend, dem 19. Juni, erscheint im Tagesspiegel ein Hinweis auf die Sendung in der Kolumne "Hinter den Berliner Kulissen" von der Rathaus-Reporterin Brigitte Grunert. Dabei schreibt sie, daß es "in den Spitzen der Berliner CDU und der Kulturverwaltung" heiße, daß Stücklen auch gegen diesen Unsinn sei. Damit zeigte sich, wie schwer es Kewenig habe mit seiner Förderung des Projekts. Es erscheint in der Frankfurter Allgemeinen am selben Tag eine große Fernsehbesprechung in der Rubrik "Tagebuch" von Sybille Wirsing, in der sie zu dem Schluß kommt, daß die Sendung mit schlechten Argumenten geführt worden sei und die Diskussion um den Reichstag noch nicht das notwendige Niveau erreicht habe: "Erst wenn man allgemein bereit sein wird, anzuerkennen, daß die historische Repräsentanz unter der künstlerischen Wirkung nicht leidet, wird man eine Ebene erreicht haben, auf der sich würdig darüber streiten läßt, ob Berlin die Metamorphose des deutschen Inbegriffs zu einem Weltkunstwerk auf Zeit politisch verkraften kann."
Auf Frau Wirsings Kommentar hin schreibt Enno v. Löwenstern am 30. Juni einen Leserbrief an die Frankfurter Allgemeine. "Wenn die CDU sogar in einer so offensichtlich abwegigen Sache statt Haltung und Stilgefühl ein Plastikrückgrat zeigt, wenn sie selbst hier hinter des Kaisers neuen Kleidern herrennt, solange sie nur aus Plastik und von der >internationalen Fachkritik< verordnet sind - wie will diese Partei jemals regieren, das heißt, dieses Land in viel komplizierteren Fragen zu Vernunft und Geschmack zurückführen?"
Inzwischen allerdings hat die Sendung etwas Bedeutenderes bewirkt. Seitdem Christo die Vorbereitungen für seine Ausstellung im Künstlerhaus Bethanien getroffen hatte, war er bemüht, mit dem Regierenden Bürgermeister Richard von Weizsäcker zu sprechen, wie er seinerzeit Gespräche mit den Regierenden Bürgermeistern Schütz und Stobbe geführt hat. Von Weizsäcker war nicht sehr geneigt, Christo zu treffen. Nach der Sendung stellt sich heraus, daß v. Weizsäcker die Diskussion gesehen und das Gefühl hatte, Christo habe die stärkeren Argumente. Er teilt dies Senator Kewenig mit, mit dem Wunsch, bei Gelegenheit einen Termin mit Christo herbeizuführen, denn er wisse, daß Kewenig dies seit langem wünsche.
Mit dem Austritt der F.D.P. aus der Bundesregierung am 17. September und dem Sturz der SPD-Regierung am 1. Oktober kommt die politische Szene erneut in Bewegung, so daß der Regierende Bürgermeister keine Möglichkeit finden kann, das Gespräch mit Stücklen in dieser Angelegenheit zu suchen.
